|
|
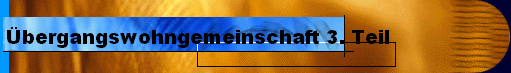 |
|||
|
7 Struktur Durch individuell unterschiedliche Prozesse und Ziele auf der einen und dem für alle geltenden Reglement, Rahmen und Programm auf der anderen Seite entsteht ein Spannungsfeld, welches zur Auseinandersetzung mit sich und anderen anregt, aber auch Perspektiven und Sichtweisen über die eigenen Grenzen hinaus ermöglicht. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen konfrontieren dabei die Klienten und Klientinnen mit ihren Wahrnehmungen und Einstellungen, so daß ein Prozeß des wechselseitigen Lernens durch Spiegelung, Projektion und Übertragung entstehen kann. Davon ausgehend, daß sich Drogenabhängigkeit aus einem individuellen Bedingungsgefüge heraus entwickelt, kann der Ausstiegsprozeß nicht uniform und ohne Berücksichtigung der persönlichen Biographie, Drogenkarriere und Ressourcen strukturiert werden. Der Betreuungsansatz ist auf den Klienten und die Klientin ausgerichtetet und läßt eine personenbezogene Aufenthaltsplanung zu. Dies wird durch die Differenzierung der Betreuungs- und Therapiemethodik, die Individualisierung der Maßnahmen und Strukturen und durch die Flexibilisierung der Aufenthaltszeit erreicht. Abhängigkeit darf trotz allem nicht nur als individuelles Problem mißverstanden werden, sondern muß in seinen biologischen, physischen, psychischen, sozialen und gesellschaftlichen Bezügen gesehen werden. Daher sind einige Grundregeln für alle Klienten und Klientinnen verbindlich, andere Regeln können zwischen der Gruppe und dem Team vereinbart werden. In einer prospektiven, multizentischen Studie über Therapieabbrüche bei der stationären Behandlung von Drogenabhängigen wurden vom Institut für Therapieforschung in München die Effekte von Behandlungsmerkmalen analysiert. Dabei wurde deutlich, daß Einrichtungen wie die ÜWG durch nachfolgende Charakeristikas hinsichtlich einer höheren Haltequote auffallen: n Sie gehören zu einer Therapiekette nSie betreiben eine spezifische Klienten- und Klientinnenselektion nSie führen häufiger erlebnispädagogische Maßnahmen durch nIhr Therapieangebot ist in zeitlicher Hinsicht weniger umfangreich nSie üben weniger Kontrollmaßnahmen aus nSie führen keine Sanktionen durch nBei der Entlassung von Klienten und Klientinnen sind diese selbst beteiligt nEs besteht eine Sperrfrist bei WiederaufnahmenDen Rahmen der Betreuung in der ÜWG bilden individuelle Strukturen, flexible Aufenthaltszeiten, differenzierte Therapiemethoden und -maßnahmen sowie verbindliche Grund- und Projektregeln. 7.1 Differenzierung Durch die unterschiedliche Gewichtung von Einzel- und Gruppenarbeit, Arbeitsprojekten oder Erwerbstätigkeit, geschlechtsspezifischer Arbeit, Schuldner- und Schuldnerinnenberatung, aktiver und kreativer Freizeitgestaltung sowie medizinischer Betreuung wird die Differenzierung der Betreuungs- und Therapiemethodik deutlich. 7.2 Individualisierung Individuelle Prozesse und Ziele stehen dem Rahmen und dem Programm und damit der Gemeinsamkeit innerhalb der ÜWG gegenüber. Auf dieser Basis entsteht ein Spannungsfeld, das Auseinandersetzungen mit sich und anderen anregt, zunächst gedankliche Perspektiven und Sichtweisen und später Handlungen über die eigenen Grenzen hinaus ermöglicht. Die ÜWG verbindet mit diesem Konzept den Versuch, notwendige Gemeinsamkeiten wie z.B. die Drogenfreiheit oder die gemeinsame eigenverantwortete Organisation des Alltagslebens zu nutzen, um individuelle Entwicklung und Orientierung zu ermöglichen und damit gezielt auf weiterführende Einrichtungen oder eine eigenständige Lebensführung vorzubereiten. Individuelle Maßnahmen und Strukturen ermöglichen auf den Einzelfall bezogene Interventionen, Rahmenbedingungen und Regeln. Die ÜWG ermöglicht die erneute Stabilisierung und den Quereinstieg nach einem Rückfall. Im Einzelfall stellt sie ein Intervallangebot mit mehreren Aufenthaltssequenzen im Wechsel mit Integrationsphasen bereit. Eine kurzfristige Stabilisierung ist in Krisensituationen für ehemalige Klienten und Klientinnen möglich 7.3 Flexibilisierung Im Verlauf der adaptiven Indikationsstellung wird die Aufenthaltszeit dem Entwicklungsstand jeweils hinsichtlich der Stabilisierungs-, Orientierungs- und Realisierungsphase angepaßt. Dadurch können Über- und Unterforderungen sowie unnötige Hospitalisierungseffekte vermieden werden. Die Dauer des Aufenthalts in der ÜWG ist demnach von der Eigenmotivation, der Schnelligkeit in dem Erreichen individueller Therapieziele und von weiterführenden ambulanten oder stationären Betreuungsangeboten abhängig. Im Verlauf des Aufenthaltes wird gemeinsam im Sinne einer adaptiven Indikation überprüft, inwieweit gesteckte Ziele bereits erreicht wurden oder neue Ziele definiert werden müssen. Letztlich richtet sich der Entlassungszeitpunkt an dem Erreichen der individuell festgelegten Aufenthaltsziele aus. Diese sollten dem Entwicklungspotential angemessen sein und können sich im Verlauf des Aufenthalts ohne weiteres mehrfach verändern. Als Indikationskriterien sind hier vor allem die Art, das Ausmaß, die Schwere und die Dauer der Drogenabhängigkeit, Persönlichkeitsvariablen und soziale Umweltressourcen sowie Erfahrungen mit vorangegangenen Therapien und cleanen Lebensphasen von Bedeutung. 7.4 Regeln Auf dem Hintergrund individualisierter Strukturen sind die Grundregeln für alle Klienten und Klientinnen der ÜWG verbindlich. Sie sind durch die Konzeption vorgegeben. Der Betreuungsvertrag beinhaltet neben den Grundregeln eine genaue Differenzierung der Projektregeln. Diese werden von den Klienten und Klientinnen und den MitarbeiterInnen gemeinsam erarbeitet und beschlossen. Ein größtmögliches Maß an Eigenverantwortung soll gewahrt und gefördert werden, damit an die Stelle von „Du darfst nicht“ ein „Ich will nicht“ tritt. Die Regeln werden so als notwendiger Schutz und als ein erster Schritt in ein drogenfreies Leben akzeptiert. 7.4.1 Grundregeln Eigenverantwortung und Eigeninitiative sind die Basis für das Zusammenleben in der ÜWG. Zur Unterstützung gelten folgende Grundregeln: n Weder innerhalb noch außerhalb der ÜWG dürfen Drogen, Alkohol oder nicht verordnete Medikamente eingenommen, gebraucht oder auch nur besessen werden. nDie Androhung und das Anwenden von körperlicher Gewalt sowie der Besitz von Waffen, feststehenden Messern etc. ist verboten.Ein Verstoß gegen diese Grundregeln führt in aller Regel zur sofortigen disziplinarischen Entlassung. Eine Wiederaufnahme ist jedoch nach einer bestimmten Zeit im Sinne eines Quereinstiegs möglich. 7.4.2 Projektregeln Die Klienten und Klientinnen verpflichten sich in einem Betreuungsvertrag, aktiv am Konzept der Haus- und Betreuungsgemeinschaft mitzuwirken. Dies beinhaltet die regelmäßige Teilnahme und Mitarbeit an Gruppen- und Einzelsitzungen, an Gruppen- und Freizeitaktivitäten sowie an der Instandhaltung und Renovierung des Hauses. Die Klienten und Klientinnen sind für die Verpflegung, die Reinhaltung und den Garten sowie für die Organisation des Hausalltags selbst verantworlich. Aus der ÜWG heraus dürfen Klienten und Klientinnen nur einer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit nachgehen. Einzige Ausnahme stellen sozialversicherungsfreie Tätigkeiten in Absprache mit den zuständigen Kostenträgern (Sozialamt, Arbeitsamt, Krankenkasse, Rentenversicherungsträger) dar. Schwarzarbeit etc. läßt sich mit den Zielen der Einrichtung nicht vereinbaren. Die zum Jahresende 1994 gültige Fassung der Projekt- und Hausregeln wird an dieser Stelle exemplarisch veröffentlicht. 7.4.2.1 Die Woche Montags bis Freitags findet um 09.00 Uhr eine Frühbesprechung im Gruppenraum statt. In dieser werden Termine, Aktivitäten und interne (projektbezogene) sowie externe Arbeitsprojekte besprochen. Sie wird von dem oder der Projektverantwortlichen geleitet, die Teilnahme ist für alle Klienten und Klientinnen, die nicht arbeiten oder zur Schule gehen verpflichtend. Ausnahmen müssen mit einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin abgesprochen und in die Anwesenheitsliste eingetragen werden. Interne Arbeitsprojekte müssen bis 17.00 Uhr erledigt sein und werden dann von dem oder der Projektverantwortlichen kontrolliert. Die Projektgruppe findet jeden Montag um 19.00 Uhr im Gruppenraum statt. Die Teilnahme ist für alle Klienten und Klientinnen der ÜWG verpflichtend. Die Hausgruppe findet für die Klienten bzw. Klientinnen vom Jägerring 8a am Mittwoch um 18.00 Uhr, vom Jägerring 8b am Donnerstag um 19.00 Uhr, vom Jägerring 8c am Dienstag um 18.00 Uhr, vom Jägerring 8d am Mittwoch um 20.00 Uhr, vom Kirchseeonerweg 1 am Dienstag um 20.30 Uhr und vom Birkenweg 1 am Donnerstag um 18.00 Uhr statt. Die Teilnahme ist für alle Klienten und Klientinnen des entsprechenden Hauses verpflichtend. Ab 23.00 Uhr bis zum Wecken gilt Nachtruhe. In dieser Zeit sollte niemand durch Fernseher, Stereoanlagen, Türenschlagen und sonst welchen Lärm gestört werden. Tagsüber sollte die normale Zimmerlautstärke nicht überschritten werden. 7.4.2.2 Wege nach Draußen Während der ersten 14 Tage dürfen neue Klienten und Klientinnen nicht ohne Begleitung das Grundstück verlassen. Ausnahmen, insbesondere wegen Schule oder Beruf, müssen in der Hausgruppe abgesprochen werden. Klienten und Klientinnen der Häuser am Jägerring müssen jeden Ausgang bis zur letzten S-Bahn beendet haben. Die Klienten und Klientinnen der Häuser am Jägerring müssen sich vor Verlassen des Grundstücks bei einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin abmelden und nach ihrer Rückkehr wieder anmelden. Zudem müssen sie sich auf der dafür vorgesehenen Liste eintragen (mit Rückkehrzeit). Übernachtungen in einem anderen Haus müssen einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin mitgeteilt werden. Nach dem zweiten Aufenthaltsmonat können Klienten und Klientinnen nach Absprache in der Hausgruppe, in der mindestens ein hauptamtlicher Mitarbeiter oder eine hauptamtliche Mitarbeiterin anwesend sein muß, auswärtig übernachten, müssen allerdings am darauffolgenden Tag zwischen 08.00 und 09.00 Uhr bzw. an Wochenenden oder Feiertagen zwischen 08.00 und 12.30 Uhr in die ÜWG zurückkommen. In Krisenfällen kann natürlich auch früher zurückgekommen werden. Darüberhinaus können Klienten und Klientinnen, die über vier Monate in der ÜWG leben, nach Absprache in der Hausgruppe, in der mindestens ein hauptamtlicher Mitarbeiter oder eine hauptamtliche Mitarbeiterin anwesend sein muß, mehrere Tage Urlaub machen. Dabei bleibt die Verpflichtung zur Teilnahme an der Hausgruppe bestehen. Nach dem sechsten Aufenthaltsmonat entfällt die Verpflichtung zur Teilnahme an der Hausgruppe. 7.4.2.3 Verantwortungs- und Aufgabenbereiche Die Klienten und Klientinnen legen in jeder Projektgruppe die Verantwortungs- und Aufgabenbereiche für die kommende Woche fest. Verantwortung heißt hier Koordination und Kontrolle der anfallenden Aufgaben und deren Durchführung. Am Anfang eines jeden Tages werden die verschiedenen Aufgabenbereiche aufgeräumt und geputzt. Klienten und Klientinnen, die tagsüber nicht im Haus sind, holen dies am Abend nach. 7.4.2.4 Absprachen Alle apothekenpflichtigen Medikamente von Klienten und Klientinnen der Häuser am Jägerring, mit Ausnahme der „Pille“ (Monatspackung), werden im Teamzimmer abgegeben und dort bei Bedarf und Absprache ausgegeben. Die Tagesdosis für mehrmals täglich einzunehmende Medikamente kann einmal pro Tag ausgegeben werden. Wund- und Heilsalben können für die Dauer der Anwendung bei dem jeweiligen Klienten oder bei der jeweiligen Klientin verbleiben. Der Besuch von drogengebrauchenden Menschen ist nicht möglich. Jeder Besucher und jede Besucherin muß sich jederzeit einer Drogenfreiheitskontrolle mit negativen Ergebnis unterziehen können. BesucherInnen dürfen nur mit Zustimmung aller Klienten und Klientinnen eines Hauses alleine in dem jeweiligen Haus verbleiben. Im Einzelfall können Menschen, die die Stabilität anderer Gruppenmitglieder gefährden, als BesucherInnen ausgeschlossen werden. Jeder Besucher und jede Besucherin in den Häusern am Jägerring muß bei einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin an- bzw. abgemeldet werden. Übernachtungen von BesucherInnen im Haus bedürfen der Zustimmung eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin. Ehemalige Klienten und Klientinnen der ÜWG dürfen die ersten 14 Tage nach ihrer Entlassung nicht in der ÜWG übernachten. Die Fernseher dürfen in den Häusern am Jägerring erst nach 17.00 Uhr bzw. nach 14.00 Uhr an Wochenenden eingeschaltet werden. Klienten und Klientinnen, die ein Tier halten wollen, müssen dies in der Hausgruppe absprechen. Alle Klienten und Klientinnen sind verpflichtet an der Projektgruppenfreizeit (Weihnachten), an den Hausfreizeiten und ggf. an anderen verbindlichen Freizeitaktivitäten teilzunehmen. Diese Freizeitmaßnahmen werden mit Ausnahme der Verpflegung von Con-drobs e.V. finanziert. Die Klienten und Klientinnen beteiligen sich an der Auswahl, Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen zur aktiven Freizeitgestaltung. Externe Aufträge für Arbeitsprojekte werden in der Projektgruppe oder in der Frühbesprechung verteilt. Die Arbeitszeit der Klienten und Klientinnen wird mit DM 15,-- pro Stunde vergütet. Sämtliche Überschüsse aus den APs werden für die aktiven Freizeitgestaltung verwendet. Klienten und Klientinnen dürfen ein anderes Haus nicht ohne eine Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin betreten, sofern die Klienten und Klientinnen des betreffenden Hauses nicht anwesend sind. 7.4.2.5 Rechte und Pflichten Jeder Klient und jede Klientin muß sich über die aktuelle Bewerberliste informieren und kann bei einer als existentiell erlebten Bedrohung von seinem bzw. ihrem Vetorecht gegenüber zukünftigen Klienten und Klientinnen Gebrauch machen. An den Vorstellungsgesprächen sollen alle Klienten und Klientinnen des betreffenden Hauses teilnehmen. Jeder Klient, jede Klientin, jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin hat jederzeit das Recht, eine projekt- oder hausbezogene Sondergruppe einzuberufen. Nach 22.00 Uhr können Sondergruppen nur in Bezug auf Grundregelverstöße stattfinden. Die Teilnahme ist für alle anwesenden Klienten und Klientinnen verpflichtend. Der Wunsch nach einem Umzug von einem Haus in ein anderes wird analog zu den Regelungen in Bezug auf externe BewerberInnen behandelt. Der Gruppenraum darf grundsätzlich nicht mit Schuhen betreten werden. Pro Monat kauft Con-drobs e.V. zwei grüne Karten. Diese sollen primär von Klienten und Klientinnen genutzt werden, die Ämter, Ärzte, o.ä. aufsuchen müssen. Die Kartenausgabe erfolgt persönlich zwischen 08.00 und der Frühbesprechnung. Nach der Frühbesprechung können die Karten auch für andere Aktivitäten abgeholt werden. Sie werden nach der Reihenfolge der Anfrage ausgegeben und müssen sofort nach Wegfall des Bedarfs, spätestens jedoch um 01.00 Uhr zurückgegeben werden. Regelverstöße werden mit einer einmonatigen Kartensperre geahndet. 7.4.2.6 Eigenbeteiligung Jeder Klient und jede Klientin bezahlt monatlich DM 12,-- für Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Gewürze, ect. in die Hauskasse und DM 8,-- für die Verpflegung Shandors (Haushund) sowie DM 20,-- für Getränke an die Verwaltungsmitarbeiterin ein. 7.4.2.7 Drogenfreiheitskontrollen Um die Urinkontrollen abrechnen zu können, muß sofort nach dem Einzug und dann jeweils zum Quartalsanfang ein Überweisungsschein an das Klinikum Rechts der Isar zur ambulanten Drogenfreiheitskontrolle bei dem zuständigen Mitarbeiter oder der zuständigen Mitarbeiterin abgegeben werden. Liegt am siebten Tage nach der Aufnahme bzw. nach dem Quartalsanfang kein Überweisungsschein vor, so sind unverzüglich DM 480,-- (Kosten der ambulanten Drogenfreiheitskontrolle) bei der Verwaltungsmitarbeiterin zu hinterlegen. Sollten weitere Kontrollen erforderlich sein, so ist die gleiche Summe jeweils am Tage der Untersuchung fällig. 8 Betreuungs- und Therapieangebote Der Aufenthalt in der ÜWG dient in erster Linie der Identitäts- und Persönlichkeitsnachbildung. Die Wiederherstellung und Erhaltung der körperlichen und psychischen Gesundheit, der körperlichen, geistigen und psychischen Leistungsfähigkeit, der sozialen und beruflichen Wiedereingliederung und der Erwerbstätigkeit sind Voraussetzung für ein dauerhaftes drogenfreies Leben. Diese Zieldefinition darf jedoch nicht zum Selbstzweck verkommen. Vielmehr steht die Erlangung von Autonomie und Unabhängigkeit durch die Aufarbeitung der individuellen Autobiographie, der Aufbau und die Stabilisierung von Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen durch die Förderung persönlicher Ressourcen, die Entwicklung von Entscheidungsfähigkeit und angemessener Risikobereitschaft durch die Übernahme von Eigenverantwortung, die Veränderung des Bezugsrahmens und der Perspektiven sowie die Klärung von Beziehungen im Vordergrund. Diese Betreuungs- und Therapieziele werden durch die unterschiedliche Gewichtung (adaptive Indikationsstellung) projektbezogener und haus- bzw. kleingruppenbezogener Betreuungs- und Therapieangebote erreicht. Die Betreuungs- und Therapieangebote haben grundsätzlich einen freiwilligen Charakter. Lediglich die Gruppen- und Einzelgespräche sowie interne Arbeitsprojekte sind verbindlich. Darüber hinaus sind alle Klienten und Klientinnen gehalten, einer Schul- und Berufsausbildung oder einer geregelten Arbeit nachzugehen. Ziel und Aufgabe der Betreuungsangebote ist die Reflexion des gesamten sozialen Systems, die Überprüfung von Entscheidungsprozessen und Lebensrealität und die Übernahme von Verantwortung für sich und für andere. Die Teammitglieder treten sowohl auf professionellem als auch auf persönlichem Niveau in die Interaktion mit den Klienten und Klientinnen und engagieren sich zusammen mit diesen in allen Angeboten. Dadurch kann nicht nur die persönliche Psychopathologie in ihrer therapeutischen und alltäglichen Facette erlebt und verändert werden, sondern können auch mannigfaltige Vorbildfunktionen erschlossen werden. Bei dem zuständigen Case-manager (Fallverantwortlichen) oder der zuständigen Case-managerin (Fallverantwortlichen) fließen alle Informationen aus den unterschiedlichen Betreuungsbereichen und Alltagsbezügen zusammen. Die Kommunikation muß teamintern symmetrisch verlaufen, um die Informationen allen an der Betreuung Beteiligten zugänglich und nutzbar zu machen. Letztlich trägt das Projekt-Team die Verantwortung für alle therapeutischen, sozialen, administrativen und juristischen Fragen betreffend eines Klienten oder einer Klientin. 8.1 Hausbezogene Betreuung Für die haus- bzw. kleingruppenbezogenen Betreuungsangebote sind jeweils zwei therapeutische Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen zuständig. Diese teilen sich die Einzelbetreuungen paritätisch auf und leiten die Gruppensitzungen gemeinsam. 8.1.1 Einzelbetreuung Jeder Klient und jede Klientin wird während der gesamten Aufenthaltszeit in einem Projektteil von einem festen Case-manager oder einer festen Case-managerin mit individueller Intensität betreut. Der oder die Fallverantwortliche integriert alle Informationen aus dem Umfeld des Klienten oder der Klientin. Damit ist ein vertraulicher Rahmen gegeben, in dem die individuelle Lebenssituation und Suchtproblematik bearbeitet werden kann. Entscheidend und primär ist im diagnostisch-therapeutischen Prozeß die Beziehung zwischen der Persönlichkeit des Klienten oder der Klientin und des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin. Diesen Rapport herzustellen und zu erhalten, ist die vordringlichste Aufgabe in der Einzelbetreuung. Die Anwendung therapeutischer oder sozialpädagogischer Methoden tritt so deutlich hinter die Beziehungsarbeit zurück. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterstützen die Klienten und Klientinnen bei der Regelung und Lösung von sozialen und wirtschaftlichen Belangen, der beruflichen und sozialen (Re-)Integration, der Vermittlung von Arbeitserprobungsmaßnahmen und beim Erarbeiten von sinnvollen Zukunftsperspektiven. Durch die Auseinandersetzung mit der momentanen Situation sollen realistischere Selbsteinschätzung und Realitätsprüfung gefördert und alte Suchtmechanismen transparent gemacht werden (Förderung der Ich-Funktionen). Die Konfrontation mit der Suchtproblematik gibt erste Anreize, sich mit der Entstehung der Sucht und den zugrundeliegenden Konflikten auseinanderzusetzen. Sie kann somit zur Motivation für eine weiterführende Therapie beitragen und wichtige Punkte aufzeigen, die in bisherigen Therapien noch nicht bearbeitet wurden. Im Mittelpunkt des Interesses steht das Erkennen und Lösen der aktuellen Problemstellungen, wodurch eine zu starke Regression, ein Zurückfallen in frühere Erlebnis- und Verhaltensmuster, verhindert wird. Nicht zuletzt unter diagnostischen Aspekten ist die Einzelbetreuung am Beginn des Aufenthalts stärker betont. Darüberhinaus können besondere persönliche Schwierigkeiten häufig besser im Rahmen einer Einzelbetreuung bearbeitet werden. Im weiteren Aufenthaltsverlauf erlangt die Gruppenarbeit ein immer größeres Gewicht. Der Wunsch nach Einzelgesprächen sollte immer stärker von dem Klienten oder der Klientin ausgehen. 8.1.2 Behandlungsplanung Der jeweilige Case-manager oder die jeweilige Case-Managerin plant zusammen mit dem Klienten oder der Klientin den Aufenthalt und dessen Inhalte. Dabei steht anfangs die Anamnese und Diagnosestellung, später die sich daraus ergebende selektive Indikationsstellung im Mittelpunkt. Im Rahmen der adaptiven Indikationsstellung werden unterschiedliche Betreuungsinhalte und -angebote differenziert verabredet und gemeinsam überprüft. Darüberhinaus werden individuelle Strukturen festgelegt und wird die Aufenthaltszeit sowie ein ggf. notwendiger Umzug in einen anderen Projektteil bestimmt. 8.1.3 Gruppenarbeit In den Gruppensitzungen werden organisatorische Angelegenheiten des Hauses besprochen und Beschlüsse gefaßt, die das Zusammenleben regeln. Die Gruppe ist der Ort, in den alle ihre momentane Situation und die damit verbundenen Themen einbringen. Das Leben in einem Haus mit sechs Menschen, stellt ein therapeutischen Setting dar, in dem sich unterschiedlichste Interaktionsprozesse ergeben und spezifische Eigendynamiken in der Gruppe entwickeln. Da jedes Individium ein soziales Wesen ist, bietet sich die Gruppe als natürliches Setting, in dem sowohl interpersönliche als auch intrapersönliche Konflickte und Beziehungen erlebt, durchgearbeitet und geklärt werden können. Individuelle Schwierigkeiten werden um das Spektrum der anderen erweitert und durch die Spiegelwirkung für den einzelnen leichter ersichtlich. Die Erfahrung, daß die anderen ähnliche Ängste haben, mindert die persönliche Spannung und hilft Minderwertigkeitsgefühle abzubauen. Neben aktuell anstehenden Fragestellungen werden unterschiedliche Informationen und Bezugssysteme zur Symptomatik der Gruppenmitglieder hergestellt. Dabei wird der Begriff und die Bedeutung von Abhängigkeit als ein universelles und ganz natürliches Phänomen von Leben und von Lebewesen dargestellt. Um diese Terminologie erlebbar zu machen, wird grundsätzlich zwischen unvermeidbaren und vermeidbaren Abhängigkeiten unterschieden. Desweiteren werden die unterschiedlichen Aspekte der Abhängigkeit von zwischenmenschlichen Beziehungen, von Stoffen sowie von Handlungsstrukturen beleuchtet und in übergreifende Sinnzusammenhänge eingeordnet. Dadurch kann ein entspannteres Verhältnis zur eigenen Abhängigkeit erlangt werden. Vorstellungsgespräche mit neuen Klienten oder Klientinnen finden in dem für die Aufnahme vorgesehenen Haus im Beisein aller Klienten oder Klientinnen und einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin der entsprechenden Gruppe statt. Hausbezogene Sondergruppen ermöglichen die Klärung aktueller Krisen, Konflikte und Beziehungen. 8.1.4 Beziehungsgespräche Den Klienten und Klientinnen der Orientierungs- und Realisierungsphase steht es frei, Angehörige, Partner, Partnerinnen, Freunde oder Freundinnen zu einem Beziehungsgespräch im Beisein eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin einzuladen. In diesem Rahmen können Interaktionsprobleme mit dem sozialen Umfeld therapeutisch bearbeitet, Beziehungen geklärt, Kränkungen verarbeitet und neue gemeinsame Perspektiven entwickelt werden. Dabei steht der Aufbau von gegenseitigem Interesse, Verstehen, Unterstützen, Bestärkung und von neuen Kontaktformen im Vordergrund. Nicht immer steht dabei die Harmonisierung der Beziehung im Vordergrund. Vielmehr legen wir großen Wert darauf, die Partner und Partnerinnen damit vertraut zu machen, daß sie auch etwas für sich selbst tun und sich selbstständig entwickeln müssen. Weitere familientherapeutische Maßnahmen können im Einzelfall vereinbart werden. 8.2 Projektbezogene Betreuung Projektbezogene Therapie- und Betreuungsangebote richten sich an alle in der Orientierungs- (ÜWG II) und Realisierungsphase (ÜWG III) lebenden Klienten und Klientinnen. Sie werden von allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen dieser Projektteile angeboten. Auch hier ist eine klare Abgrenzung zwischen haus- und projektbezogener Betreuung nicht möglich. Viele der hier beschriebenen Betreuungs- und Therapieangebote werden auch in der Arbeit mit der Kleingruppe eines Hauses realisiert. Dabei kommen dem alltäglichen Kontakt, der lebenspraktischen Beratung, der Beziehungsarbeit und der Krisenhilfe besondere Bedeutung zu, da diese Beziehungsangebote von den Klienten und Klientinnen jederzeit in Anspruch genommen werden können. Die Anwesenheit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat eine angstreduzierende Wirkung, da sich diese als angreifbare, verletzbare, aber dennoch nicht zerstörbare persönlichkeiten zeigen. 8.2.1 Gruppenarbeit Projektbezogene Gruppenarbeit läßt sich nach der Erweiterung 1995 nicht mehr konsequent für alle Klienten und Klientinnen der ÜWG realisieren. Dennoch haben die Klienten und Klientinnen der Orientierungs- und Realisierungsphase häufig Gelegenheit zur Großgruppenarbeit. In der wöchentlich statfindenden Projektgruppe werden alle organisatorischen Angelegenheiten der ÜWG II und ÜWGIII besprochen, Regeländerungen diskutiert und beschlossen sowie hausübergreifende Themen wie Eigenverantwortlichkeit und Rückfälligkeit bearbeitet. Gleichzeitig ist die Projektgruppe zentrales Forum zu hausübergreifender Beziehungs- und Konfliktklärung. Alle in der Projektgruppe anwesenden Klienten, Klientinnen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wählen den oder die Projektverantwortliche und besetzen einige andere zentrale Verantwortungsbereiche. Projektbezogene Sondergruppen können von jedem Klient und jeder Klientin sowie von jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin jederzeit einberufen werden. Häufig sind dabei akute Krisen und Konflikte Anlaß. Themenspezifische Gruppen oder Workshops bieten die Möglichkeit der vertiefenden Auseinandersetzung mit zentralen Themen des Projekts. 8.2.2 Themenzentrierte Angebote 8.2.2.1 Freizeitgestaltung Einen Teil der Freizeit strukturieren und planen die Klienten und Klientinnen zusammen mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Hierzu zählen sportliche, erlebnistherapeutische, kreative, musikalische und kulturelle Möglichkeiten und Angebote. Die Abendstunden sowie ein Großteil des Wochenendes werden frei gestaltet. Hierbei ist es wichtig, selbständig Freizeit zu gestalten und so aus Langeweile eine lange Weile werden zu lassen. Häufig führt das Erleben einer sinnlosen Langeweile in der Freizeit gerade bei Klienten und Klientinnen, die alle sonstigen Bereiche geregelt haben, in den Rückfall. Dem vorzubeugen und sinnvolle Aktivitäten entgegenzusetzen, dient die Anleitung zu aktiver Freizeitgestaltung und damit die Möglichkeit, momentane Situationen, Gedanken, Stimmungen und Gefühle gestalterisch oder körperlich auszudrücken und zu reflektieren. Durch die erlebte Gemeinschaft werden die Gemeinsamkeiten aller stärker betont. Die entstehende Nähe dient der Beziehungsklärung, neue Erlebnisbereiche werden erschlossen und können ausprobiert werden. Durch die Gestaltung der Freizeit kann ein stabiles Netz an Kontakten und Freundschaften entwickelt und gefestigt sowie das Engagement für sich und andere und das Selbsthilfepotential der Klienten und Klientinnen angesprochen werden. Angebote, die eine "aktive gemeinsame" Freizeitgestaltung ermöglichen, werden gefördert. Besondere Bedeutung hat hier der sportliche Bereich, in dem Ausdauer, Erfolgserlebnisse, körperliche Gesundung und die Erweiterung sozialer Kontakte im aktiven Tun erlebt und erfahren werden können. Diese Erfahrungen und Fähigkeiten müssen in den Lebensalltag integriert werden. Das Bedürfnis nach besonderen, sich aus dem Alltag hervorhebenden, Erfahrungen kann gesellschaftlich akzeptiert ge- und erlebt werden und ist dabei als Rückfallprophylaxe zu nutzen. Der Gruppenprozeß und die dabei erfahrenen Kontakte tragen zur Stabilisierung der Beziehungen untereinander bei und wirken präventiv. Ergänzend werden Freizeiten und Urlaubsfahrten mit sportlichen, kulturellen oder erholsamen Inhalten angeboten. Dabei können Gemeinschaftserleben und Aktivität sowie therapeutische Inhalte miteinander verbunden, vermittelt und erfahren werden. Zur kreativen Freizeitgestaltung werden Angebote genutzt, die das künstlerische und musische Potential der Klienten und Klientinnen wecken und Möglichkeiten zu ihrer Entwicklung bieten. Zudem werden körperorientierte Aktivitäten wie Meditationen, Yoga und Selbstverteidigung angeboten. Das Erleben von aktiver Freizeit kann, genau wie im Arbeits- oder Beziehungsbereich, süchtig entgleisen. Wichtig ist hier, die Suchtverlagerung als Ressource des einzelnen zu begreifen und einer Bewußtwerdung zugänglich zu machen. Gelingt es, aus passivem Konsumieren aktives Tun werden zu lassen, erscheint dieser Vorgang durchaus sinnvoll, da er stabilisierend und unterstützend bei der Selbstfindung wirkt. Die Erfahrung, daß ohne Drogen Gipfelerlebnisse möglich sind, kann bewußt erlebt werden und in alltägliche Lebenszusammenhänge integriert oder transferiert werden. 8.2.2.2 Arbeitsprojekte Klienten und Klientinnen, die keiner geregelten Arbeit, Schul- oder Berufsausbildung nachgehen, nehmen an Arbeitsprojekten innerhalb und außerhalb der ÜWG teil. Diese sind zielgerichtet, nicht ablenkend-beschäftigend, werden als Teil der beruflichen Rehabilitation und Resozialisation angesehen und ermöglichen das Entwickeln und Realisieren von beruflichen Perspektiven. Ehemals drogenabhängige Männer und Frauen verfügen häufig über keine abgeschlossene Schul- oder Berufsausbildung. Ihre Arbeitserfahrungen sind unregelmäßig und von Wechseln, Abbrüchen sowie abnehmender Leistungsfähigkeit geprägt. Durch diesen Desintegrationsprozeß ging die Fähigkeit und Motivation zur Auseinandersetzung mit dem sozialen Umfeld verloren. Durch unterschiedliche Arbeitsprojekte wird der Alltag sinnvoll ausgefüllt und gestaltet. So wird die Notwendigkeit der Strukturierung des Tagesablaufs vermittelt und wird Selbstvertrauen sowie Motivation gefördert. Wo der Gebrauch psychotroper Substanzen als artifizielle Ich-Funktion gestanden hat, kann Arbeit und die damit verbundenen Erfolgs- Leistungs- und Kontakterfahrungen von der Zentriertheit auf interne und externe Reizüberflutungen ablenken, das Funktionsniveau erhöhen und substituierend im Sinne einer Rückfallprophylaxe wirken. Durch das Erleben der eigenen Produktivität wird das Selbstwertgefühl nachhaltig gesteigert. Das Ergebnis der Arbeit läßt den eigenen Anteil und Beitrag am Produkt als sinn- und wertvoll deutlich werden. Zudem kann das kontinuierliche Arbeitsverhalten, der Fertigkeitserwerb, das Arbeitstraining, die Realisierung eigener gestalterischer Ideen sowie die Fähigkeit zu Flexibilität, Agressionen abzubauen, sich Durchzusetzen, Konflikte zu bewältigen und kooperativ zu arbeiten in eine Ausbildung oder einen Beruf umgesetzt werden. Klienten und Klientinnen, deren Ziel es ist, im Anschluß an ihren Aufenthalt in der ÜWG unabhängig von Institutionen zu leben, bemühen sich um die Fortführung ihrer Schul- und Berufsausbildung oder gehen einer anderweitigen Erwerbstätigkeit nach. Gerade hier ist es wichtig, Realitäten des Arbeitsalltags innerhalb der Einrichtung zu problematisieren und zu thematisieren. Das weiter oben beschriebene Prinzip des Integrierens äußerer Realitäten in den Lebensraum der ÜWG wird hier wirksam. 8.2.2.2.1 Interne Arbeitsprojekte Die Übernahme von internen Arbeitsprojekten wie Reparatur- und Renovierungsarbeiten im und am Haus, die Gartengestaltung und -pflege, die PKW-Wartung und -Pflege, das kreative Gestalten der Häuser sowie die Herstellung von Einrichtungsgegenständen ist für alle Klienten und Klientinnen obligatorisch. Nach der Einarbeitung durch die Verwaltungsleiterin übernimmt ein von der Gruppe gewählter Klient oder eine von der Gruppe gewählte Klientin die Koordination und Kontrolle über die internen Arbeitsprojekte, allgemeine Verwaltungsarbeiten, das Aufnahmeverfahren und den Telefondienst. Diese Arbeit ist im höchsten Maße eigenverantwortlich und wird durch den hohen Realitätsbezug entlohnt. 8.2.2.2.2 Externe Arbeitsprojekte Berufliche Orientierung unter realistischen Alltagsbedingungen und Leistungsansprüchen wird den Klienten und Klientinnen in externen Arbeitsprojekten ermöglicht. Durch Gemeinwesenorientierte Dienstleistungen können konkrete Arbeitserfahrungen gesamelt werden. Pünktlichkeit, Kontinuität, das Erleben des eigenen Leistungsvermögens und das Einstellen auf immer neue Auftraggeber und Auftraggeberinnen sowie Arbeitssituationen erweitert die soziale Kompetenzen und fördert die Verantwortungsübernahme gegenüber anderen Menschen. Konkret werden Renovierungsarbeiten, Bürotätigkeiten, Haushalts- und Gartenhilfen und ambulante Pflegeleistungen erbracht sowie Umzüge organisiert und durchgeführt. Alle Arbeitsprojekte werden von den Klienten und Klientinnen selbständig verantwortet, organisiert und durchgeführt. Je nach individueller Leistungsfähigkeit und -bereitschaft sowie dem jeweiligen Entwicklungsstand ist eine stunden- und tageweise Beschäftigung oder aber die Übernahme der Kundenbetreuung, Arbeitsorganisation, Arbeitsüberwachung sowie der Abrechnung über einen längeren Zeitraum hinweg möglich. Die direkte Entlohnung und die mit der Durchführung von externen Arbeitsprojekten mögliche Finanzierung von aktiver Freizeitgestaltung dient dem Realitätsprinzip, ermöglicht die Teilnahme an Maßnahmen der aktiven Freizeitgestaltung und Erlebnistherapie und erhöht damit die Motivation zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft. 8.2.2.3 Schuldnerberatung Wie bei anderen Anforderungen und Konfliktsituationen des täglichen Lebens, machen sich auch im Umgang mit Geld und finanziellen Verpflichtungen bestimmte Verhaltensdefizite süchtiger Menschen bemerkbar. Ungeduld, fehlendes Durchhaltevermögen, fragliche Prioritäten, mangelnde Wertstruktur und Passivität führen dazu, daß Konsumwünsche in erster Linie durch Fremdhilfe erfüllt werden. Neben nahen Bezugspersonen kamen vor allem Drogengeschäfte, Prostitution, Beschaffungskriminalität und Kredite zur Finanzierung der Drogenabhängigkeit in Frage. Hohe Gerichts- und Anwaltskosten, Bankschulden, Schadensersatzforderungen und andere Zahlungsverpflichtungen sind oftmals Kennzeichen langjähriger Drogenabhängigkeit. Über 80% der Drogenabhängigen haben durchschnittlich DM 15.000,-- Schulden, wobei Frauen in der Regel seltener und geringer verschuldet sind als Männer. Schuldnerberatung ist unverzichtbarer Bestandteil professioneller Drogenhilfe. Dieses ergibt sich, um einen aus der oben dargestellten Verquickung von Abhängigkeitsdynamik, Illegalität des Suchtmittels, Beschaffungskosten, Kriminalisierungsfolgen und zum anderen aus dem methodischen Prinzip der ganzheitlichen und durchgängigen Betreuung, Beratung und Behandlung innerhalb der therapeutischen Wohngemeinschaft (ÜWG). Die Intergration des drogenbedingten Problemfeldes „Schulden“ in die Betreuungs- und Therapieangebote der ÜWG ermöglicht ein adäquates Bearbeiten der Symbiose von Drogenabhängigkeit und Überschuldung. Um möglichst effektive Schuldnerberatung leisten zu können, muß unmittelbar nach Bekanntwerden der Verschuldungssituation qualifizierte Beratung und Hilfe angeboten werden. Die Entschuldungshilfe basiert auf spezielle Kenntnisse im rechtlichen Bereich und erfordert Kompetenz im Kreieren, Aushandeln und Umsetzen fallspezifischer Sanierungsstrategien. Der Prozeß der Schuldensanierung nimmt in der Regel einen sehr langen Zeitraum in Anspruch, so daß die Vernetzung mit anderen Schuldenberatungsstellen, Verbraucherberatungen und -zentralen, Entschuldungsfonds, Rechtsanwälten sowie öffentlichen Stellen nötig erscheint. Je früher eine Entschuldung eingeleitet werden kann, desto größer ist die Chance einer erfolgreichen Rehabilitation. In diesem Zusammenhang sind besonders Drogenberatungsstellen und stationäre Therapieeinrichtungen gehalten, diesem Problem einen größeren Stellenwert beizumessen. Der Informationsfluß und die Datenübermittlung beim Wechsel in eine andere Einrichtung sollten selbstverständlich sein, ansonsten würde der Sanierungsprozeß unnötig verzögert oder gar abgebrochen. Die ÜWG sieht dies als Selbstverständlichkeit an und hofft auf kooperative Zusammenarbeit. Voraussetzung für die Schuldnerberatung in der ÜWG ist die Bereitschaft, ab dem Beginn der Beratung mindestens DM 40,-- monatlich zur Schuldentilgung bereitzustellen. Klienten und Klientinnen die erwerbstätig sind, müssen mindestens 20% der Differenz zwischen Arbeitsendgeld und Sozialhilfe hierfür aufwenden. Darüberhinaus ist die aktive Mitarbeit bei dem Zusammenstellen aller relevanter Unterlagen, der Kontaktaufnahme mit den Gläubigern, der Schuldensanierung und der Erstellung eines Tilgungs- und Haushaltsplanes als Bedingung anzusehen. Näheres wird in einem Schuldnerberatungsvertrag geregelt. Je früher den KlientInnen - auch im Stadium langjähriger Abhängigkeit - die aktuelle Schuldensituation bewußt wird und durch fachliche Hilfestellung gezeigt werden kann, daß sich ein weiterer Schuldenanstieg abbremsen läßt, bei Zwangsvollstreckungsmaßnahmen von Gläubigern Grenzen gesetzt sind, Tilgungsarrangements fruchten und spezielle Umschuldungsfonds für Straffällige und Drogenabhängige existieren, die eine spätere Sanierung unterstützen können, desto eher erscheint die subjektiv drückende Schuldensituation als beherrschbares Problem. Die realistische Chance auf eine wirtschaftliche Lebensperspektive (soziale Integration auf einer gesicherten materiellen Grundlage) ist eine wesentliche Vorraussetzung, um Therapiemotivation zu wecken und ein „Durchhalten“ in der Therapie und in Ausbildungsmaßnahmen erwarten zu lassen. Es ist deutlich zu machen, daß sich durch die Mitarbeit des Klienten oder der Klientin in der Regel eine finanzielle Perspektive entwickeln läßt. Grenzen der Sanierungsbemühungen ergeben sich sowohl aus dem individuellen Verhalten des Klienten oder der Klientin, als auch durch die beschränkten rechtlichen Möglichkeiten des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin. Schuldnerberatung in der therapeutischen Arbeit steht immer im Spannungsfeld therapeutischer Prioritäten und Notwendigkeiten und darf sich nur an den individuellen Zielvorstellungen des Klienten oder der Klientin orientieren. 8.2.2.4 Schul-, Ausbildungs- und Berufsberatung Der weitaus größere Teil der Klienten und Klientinnen der ÜWG verfügt zum Zeitpunkt der Aufnahme über keine abgeschlossene Berufsausbildung. Die meisten blicken auf eine oder mehrere abgebrochene Lehren zurück, manche haben nach Erwerb des (qualifizierten) Hauptschulabschlusses oder - seltener - der Mittleren Reife verschiedenste Hilfstätigkeiten aufgenommen und mit diesen zumindest zeitweise ihr Leben finanziert. Unzufriedenheit und Frustrationen im Berufsleben wurden zu suchtverlängernden und rückfallprovozierenden Faktoren. Die Chancen auf den Erwerb von Arbeit und die Integration in den Arbeitsmarkt ist aufgrund der bislang eher niedrigen Qualifikation für die meisten Klienten und Klientinnen der ÜWG nicht einfach. Häufig sind die erreichbaren Tätigkeiten auch mit einem niedrigen gesellschaftlichen Status verbunden. Strafrechtliche Stigmen und lange Ausfallzeiten in der schulischen oder beruflichen Ausbildung oder im Arbeitsleben erschweren und verhindern die Einstiegsmöglichkeiten nach der Drogenabhängigkeit. Erwerbstätigkeit ist jedoch die Voraussetzung für ökonomische Unabhängigkeit und eine selbständige Lebensführung sowie ein wesentlicher Faktor zur Stabilisierung des Selbstwertgefühls. Bei Eintritt in die ÜWG wird zunächst die schulische und berufliche Ausgangssituation des Klienten oder der Klientin geklärt: Welcher Schulabschluß liegt vor, welche Lehren wurden begonnen oder abgeschlossen? Welche Tätigkeiten wurden bisher ausgeübt? Welche sonstigen Fähigkeiten und Fertigkeiten sind vorhanden? Anschließend wird versucht - soweit dies zu diesem Zeitpunkt möglich ist - eine Klärung der schulischen und beruflichen Ziele zu erreichen. Hierbei handelt es sich ebenso um kurzfristige Ziele (Geld verdienen, Beschäftigung, Alltagsstrukturierung) wie auch um mittel- und langfristige Ziele (Integration in den Arbeitsmarkt, Erhöhung der Chancen auf dem Arbeitsmarkt, Steigerung des schulischen und beruflichen Status, Steigerung des Selbstwertgefühls). Im Verlauf des Aufenthalts in der ÜWG wird die schulische und berufliche Entwicklung immer wieder überprüft und ggf. modifiziert. Dieser Prozeß wird den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der ÜWG durch die Bereitstellung von verschiedenen Materialien über in Frage kommende Schulen, Ausbildungs- und berufliche Möglichkeiten sowie entsprechende Adressen begleitet. Darüber hinaus können sich die Klienten und Klientinnen in der Wahl der in Frage kommenden Bildungs- und Berufsstätte beraten lassen. In unregelmäßigen Abständen werden interne Veranstaltungen zu den Themen Schule, Ausbildung und Beruf durchgeführt. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterstützen die Klienten und Klientinnen schulische Abschlüsse nachzuholen, berufliche Qualifikationen zu erwerben, die Berufstätigkeit zu erproben und regen die Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt bei der individuellen Berufsfindung unter dem Aspekt der Reintegration an. Sie schaffen Kontake und Möglichkeiten, in mittelständischen Industrie- und Gewerbebetrieben zu arbeiten, engagieren sich für eine Verringerung von Vorurteilen und stehen den Ausbildungsstellen als Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen zur Verfügung. Darüber hinaus unterstützen sie selbstinitiierte und -verwaltete Ausbildungs- und Arbeitsprojekte. Hierzu ist eine enge Kooperation mit den Arbeits- und Jugendämtern sowie mit den Ausbildungsstellen und Bildungswerken erforderlich. Die Integration in vorhandene Regelschulen erfordert sehr viel Eigeninitiative, Disziplin und Ausdauer und bietet wenig Unterstützung bei den spezifischen Problemlagen. Psychische und fachliche Unterstützung ist durch die besondere Außenseiterrolle aufgrund des höheren Alters und bei Konflikten zwischen Klienten oder Klientinnen und Lehrern oder Lehrerinnen notwendig. Nach der Ausbildung und Arbeitsplatzfindung ist die Begleitung zur Stabilisierung im Arbeitsalltag und -leben (angesichts der sozialen Anforderungen wie Disziplin, Pünktlichkeit, Ausdauer und Frustrationstoleranz) nötig. Günstigstenfalls kann dies zur Integration der Arbeit in das Persönlichkeitsbild und damit zu einer Aufhebung der Spaltung zwischen Arbeits- und Privatleben führen. Alle diesbezüglichen Angebote haben Charakter der Hilfe zur Selbsthilfe: So sollen zwar Kenntnisse vermittelt werden (Welche beruflichen Möglichkeiten habe ich? Wo gibt es eine Berufsfachschule? Welche Schulen kommen in Betracht, um die Mittlere Reife nachzuholen?), die wesentlichen Schritte und Umsetzungsversuche werden aber - im Sinne der Selbstverantwortung und des Realitätsprinzips - von den Klienten und den Klientinnen selbst ausgeführt. 8.2.2.5 Ausdruckstherapie Die Ausdruckstherapie ist integraler Bestandteil des therapeutischen Prozesses in der ÜWG. Sie ermöglicht den Klienten und Klientinnen sich selbst und ihre Welt zu entdecken und eine Beziehung zwischen der Persönlichkeit und der Umwelt herzustellen. In diesem kreativen Prozeß wird die innere und äußere Realität zu einer Einheit verschmolzen. In der Auseinandersetzung mit unterschiedlichsten Materialien und Medien sowie durch verschiedene Projekte und Angebote in den Bereichen Musik, bildnerische Kunst, Video und Theater werden verschiedenstartige Gestaltungsmöglichkeiten erschlossen und eine Alternative zu einem oft ausschließlich passiven Konsumverhalten geboten. Schwellenängste können überwunden und neue oder wiederentdeckte Gefühle können verbal wie nonverbal ausgedrückt werden. Mit der Entwicklung und Entdeckung kreativer Fähigkeiten kann sich der Klient oder die Klientin intensiv mit sich selbst auseinandersetzen und selbst aktiv werden. Das Erleben der eigenen Gefühls- und Gedankenwelt sowie das Umsetzen des Erlebten zeigt konkret umsetzbare Alternativen zu der passiven Stimulation durch Drogen. Durch das Umsetzen der eigenen bildhaften Vorstellungen in Aktionen, mit der oft vorausgegangenen Wahrnehmungs-verlagerung, lassen sich neue Lösungswege spielerisch vorwegnehmen und so erlernen. Das Selbstbewußtsein und die Selbsterkenntnis wird durch das Entdecken der eigenen Kreativität, deren Umsetzung und durch die Präsentation des selbst Hervorgebrachten gefördert. Dabei müssen eigene Grenzen und Hemmschwellen überwunden und Mut gezeigt werden. 8.2.2.6 Sozio- und psychotherapeutische Angebote Die im folgenden beschriebenen sozio- und psychotherapeutischen Angebote der ÜWG - Psychodrama, Körpertherapie, Soziales Kompetenztraining - sind im Kern durch die Prinzipien Selbstverantwortung und Realitätsbezug miteinander verbunden. Die Klienten und Klientinnen der ÜWG können, wenn sie sich auf diese Angebote einlassen, ihre eigene Selbstverantwortung wie auch die der Gruppe gegenüber stärken. Damit gehen sie einen wesentlichen Schritt aus der Drogenabhängigkeit und der mit ihr verbundenen Problematik heraus. Sämtliche Angebote sind auf individuelle Bedürfnisse anwendbar, haben eine große Alltagsnähe und unmittelbar verhaltensmodifizierende Anteile. Darüber hinaus kommen sie als Methoden mit hoher Transparenz dem therapeutischen Bedürfnis nach Offenheit und Klarheit entgegen. 8.2.2.6.1 Psychodrama Das Psychodrama ist eine sozio- und psychotherapeutische Methode, welche - mit den Bestandteilen Gruppentherapie, Soziometrie und Psychodrama - die beteiligten Gruppenmitglieder zu einem szenischen „acting out“ anregt. Im Gegensatz zu den meisten Therapieformen ist das Psychodrama primär nicht verbal sondern wesentlich erlebnisorientiert ausgerichtet. Dabei kann Vergangenes wiedererlebt, Gegenwärtiges gespielt oder Zukünftiges vorweggenommen werden. Auch Phantasien, Geträumtes, Ideen etc. können im psychodramatischen Spiel konkret dargestellt und für alle Beteiligten greifbar werden. Auf der Basis einer ähnlichen Biographie und gemeinsamer Problematiken, die im Verlauf des gruppentherapeutischen Prozesses deutlich werden, unterstützen und beneiden sich die Gruppenmitglieder gegenseitig und machen darin Solidaritäts- und Konkurrenzerfahrungen. Sie befinden sich dabei in einem Lernprozeß, von dem prinzipiell alle gleichzeitig profitieren können. Das Psychodrama als aktivierende Methode, welche die einzelnen Gruppenmitglieder zur Übernahme von Selbstverantwortung sowie von Verantwortung für die Gruppe animiert, stellt in seinem Ablauf einen Realitätsbezug her, der von kaum einer anderen Methode erreichbar ist: Alles ist unmittelbar vorhanden, kann direkt "erkannt" und "verwandelt" werden. Darüber hinaus erlaubt das Psychodrama als primär nicht-verbalisierende Methode ein Höchstmaß an emotionalem Erleben, welches u.a. in dem Vergnügen des Menschen begründet liegt zu spielen. Daraus resultiert ein wesentlich geringeres Ausmaß an Widerstand gegenüber Aufdeckung, Üben und Konfliktbewältigung als in primär verbalisierenden Therapieformen. Auch ist der Psychodramaleiter oder die Psychodramaleiterin kaum in Übertragungsprozesse involviert, da diese zwischen den einzenen Gruppenmitgliedern ablaufen und dort sichtbar und bearbeitbar gemacht werden können. Die zahlreichen Formen der Psychodramatherapie (protagonisten-, themen-, gruppenzentriertes Psychodrama, Rollenspiel, Stegreifspiel) sowie die prinzipielle Offenheit des psychodramatischen Zugangs im Spiel bieten vielfältige methodischen Möglichkeiten, um drogenabhängige Menschen, die zwar über keine klare gemeinsame Grundstörung, doch aber über gemeinsame Erfahrungen verfügen, in ihrer Entwicklung zu unterstützen. So kann auf die Vergangheit gerichtet das Erinnern und Erleben von Träumen und Konflikten aufdeckend und kathartisch wirken. In der spielenden Beschäftigung mit bestimmten Themen können Lern- und Erkenntnisprozesse initiert werden. Körperlichkeit und Emotionalität können im psychodramatischen Spiel vollständig und nicht im Gegensatz zu Geist und Vernunft stehend erlebt und daher ohne Widerstand angenommen werden. Konflikt- und Beziehungsfähigkeit kann geübt und wie überhaupt jedes Verhalten auf seinen Realitätsbezug hin erprobt werden. Soziometrische Verfahren verhelfen darüber hinaus zur Erkenntnis der sozioemotionalen Tiefenstruktur einer Gruppe. Die Erkenntnis des Macht- und Sympathiegefüges einer Gruppe verhilft zur Einschätzung des Standorts jeder einzelnen Person in einer Gruppe und dient darüber hinaus der Einschätzung der derzeitigen dynamischen Möglichkeiten derselben. Angebote für Klienten und Klientinnen der ÜWG bestehen in Form von psychodramatischen Wochenenden. Sie werden primär themenspezifisch (Beziehung zur Droge, Partner- und Partnerinnen-Beziehungen, Geschlechtsrollen, Körper und Verstand) veranstaltet. Darüberhinaus ist eine fortlaufende, offene projektbezogene Psychodramagruppe installiert, die sich monatlich trifft. Psychodramatage und psychodramatische Kurzspiele finden als Spontanveranstaltung zu einzelnen Themen und Konflikten statt. 8.2.2.6.2 Körpertherapie Neben zahlreichen psychotherapeutischen Methoden wie der Gesprächstherapie und der Psychoanalyse hat die Körpertherapie in den letzten Jahren besonders in der Drogen- und Suchtarbeit an Bedeutung gewonnen. Man erkannte, daß das körperliche Wohlbefinden und die damit verbundene Selbstannahme und Identifikation mit dem eigenen Ich im engen Zusammenhang mit der Suchtstruktur und Suchtausprägung steht. Die Körpertherapie bedient sich unterschiedlicher Methoden, die aus den Bereichen der Heilpädagogik und der Alternativmedizin fernöstlicher Kulturen übernommen wurden. Hier finden sich verschiedene Entspannungstechniken, körperdynamische Übungen, Meditation oder Inhalte chinesischer oder japanischer Heilkunst, wie Qi-Gong oder Yoga wieder. Diese Techniken sollen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen befähigen, die Körperwahrnehmung zu intensivieren, innere Kräfte zu aktivieren, einen Bezug zwischen geistigen und körperlichen Fähigkeiten herzustellen und zu einem gesunden und positiven Körpergefühl zu gelangen. In der Suchtarbeit ist es besonders wichtig, daß der oder die Abhängige lernt, einen Bezug zu seinem oder ihrem Körper herzustellen, dessen Signale zu deuten und so ein angemessenes positives Körpergefühl erreicht. Dieser Bezug bewirkt wiederum eine Bewußtseinsänderung, indem der Körper nicht mehr bewußt mit psychotropen Substanzen geschädigt wird, sondern versucht wird, das erlangte positive Körpergefühl zu erhalten. Desweiteren dient die Körpertherapie der Aufarbeitung von Mißbrauchs-erfahrungen, indem negative Körpererfahrungen (und damit Ablehnung des Körpers) nacherlebt und thematisiert, somit verarbeitet und durch einen positiven Bezug zum Körper (Annehmen des Körpers) ersetzt werden können. Angebote im Bereich der Körpertherapie sind in Form von themenbezogenen Gruppen realisiert. Dabei kommen verschiedene Techniken (Meditation, Traumreisen, körperdynamische Übungen aus dem Qi-Gong, Massage) zur Anwendung. Es handelt sich hierbei um offene Gruppen, in denen individuell auf die Bedürfnisse einzelner Teilnehmer eingegangen werden soll. 8.2.2.6.3 Soziales Kompetenztraining Der Begriff der "sozialen Kompetenz" meint die Fähigkeit des einzelnen Menschen zur Selbsthilfe sowie zur Kontakt- und Beziehungsaufnahme zu seinen Mitmenschen. Untrennbar damit verknüpft steht die Fähigkeit zur Übernahme von Verantwortung gegenüber sich selbst sowie gegenüber anderen Personen. Als weitere wesentliche Bestandteile "sozialer Kompentenz" werden realistische Selbst- und Fremdwahrnehmung gesehen. Trainings, welche die oben genannten Fähigkeiten vermitteln sollen, wurden in den letzten Jahren bei den unterschiedlichsten psychischen und sozialen Schwierigkeiten angewandt. Gerade bei sozialen Schwierigkeiten wie Partnerproblemen, sozialer Isolation, Kontaktschwierigkeiten, Depressionen, psychosomatischen Beschwerden etc., aber auch bei Suchtproblemen konnten große Erfolge erzielt werden. Schon in dieser Aufzählung wird deutlich, daß soziale Kompetenztrainings als besonders geeignet für drogenabhängige Frauen und Männer angenommen werden können, da die genannten Schwierigkeiten zumeist zusätzlich als Probleme im Hintergrund oder parallel zur Drogenabhängigkeit bestehen. Die spezifische Wirkung sozialer Kompetenztrainings kann einerseits auf dem Hintergrund verstanden werden, daß psychische Schwierigkeiten häufig Folge von sozialen Schwierigkeiten und Belastungen sind. Anderseits können nahezu alle psychischen Probleme oder Störungen zu sozialen Defiziten führen. So berichtet der Großteil der Klienten und Klientinnen der ÜWG aus der Zeit vor ihrer Drogenabhängigkeit von unbefriedigenden oder gar traumatischen sozialen Kontakten (Beziehungen) im Elternhaus, der Schule und der „peer-group“, welche im Zusammenhang mit der Entstehung ihrer Drogenabhängigkeit gesehen werden müssen. Während der Zeit der Drogenabhängigkeit (Scene, Gefängnis) wird außerdem bereits gelerntes, sozial kompetentes Verhalten zum großen Teil zu Gunsten von Strategien, die der Bewältigung des Drogenlebens unabdingbar sind, aufgegeben oder verlernt. Unter diesem Gesichtspunkt ist der Erwerb und das Training sozial kompetenten Verhaltens - d.h. der Abbau sozialer Angst und das Erlernen sozialer Fertigkeiten, die über das Drogensetting hinausgehen bzw. diese, wenn möglich, sinnvoll ergänzen - ein wichtiger Bestandteil im therapeutischen Prozeß zur Bewältigung der Drogenabhängigkeit. In den Gruppentrainings zur sozialen Kompetenz - wie sie in der ÜWG angeboten werden - werden verschiedene Techniken angewandt, so z.B. Wahrnehmungsübungen zur Selbst- und Fremdeinschätzung, Situationsfragebögen, Schwierigkeitsthermometer und diagnostische und übende Rollenspiele mit und ohne Videoanalyse. Bei diesen Trainings werden Fähigkeiten erworben, Situation einerseits in Bezug auf ihre Anforderungen einschätzen zu lernen, andererseits die zur erfolgreichen Bewältigung notwendigen Verhaltensweisen gelernt. Die Vorteile dieser Trainings liegen in ihrer Transparenz und ihrem einfachen Aufbau, mit dem Ziel, daß jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin auch neue, unbekannte Situationen mit dem allgemeinen Wissen aus den Trainings erfolgreich bewältigen kann (Situationstransfer). Entsprechend den moderneren Kompetenztrainings ist dabei - im Gegensatz zu den früheren Selbsicherheitstrainings - die Berücksichtigung von kurz- und langfristigen Zielen ins Zentrum gerückt. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: So mag ein Streit mit dem Vorgesetzten zu einem ersten Erfolgsgefühl führen ("Dem habe ichs aber gezeigt!"), langfristig kann dadurch aber unter Umständen der Arbeitsplatz oder die Lehrstelle gefährdet sein. Daher wird auch versucht zu vermitteln, daß Verhalten nur dann als sozial kompetent bezeichnet werden kann, wenn es die Ziele der Interaktionspartner und Interaktionspartnerinnen berücksichtigt. Für Drogenabhängige heißt dies, häufig exklusiv auf die eigene Person sowie auf die Drogenbeschaffung gerichtete Verhaltensmuster durch solche, die einen Kompromiß für alle Beteiligten beinhalten, zu ersetzten. Verhalten ist dann sozial kompetent, wenn die in der Situation wichtigen Ziele erreicht werden, die Person sich dabei wohl (o.k.) fühlt und auch die Ziele der anderen berücksichtigt werden. Die in der ÜWG angebotenen Trainings stehen in Form von Wochenendseminaren, welche ein strukturiertes Erlernen sozialer Kompetenz erlauben, zur Verfügung. Diese werden ergänzt durch themen- und situationsspezifische Intensivangebote, welche einen Zeitumfang von zwei Stunden bis zu einem Tag haben. Darüberhinaus können einzelne Übungen in die regelmäßig stattfindenden Hausgruppen integriert werden. 8.2.2.7 Computertraining Der Computer als „Werkzeug“ ist heute aus den meisten Berufsfeldern nicht mehr wegzudenken. Für viele Kinder und Jugendliche ist er zum alltäglichen Gebrauchsgegenstand geworden und als Allroundmedium in naher Zukunft wohl bald in jedem Haushalt zu finden. Häufig ist das Klientel der ÜWG durch die nicht vorhandene Ausbildung und ihr Alter nicht mit dem Umgang eines Compputers vertraut. Dadurch fehlt in vielen Bewerbungsunterlagen der Hinweis auf PC-Kenntnisse, was auch die freie Berufs- bzw. Ausbildungswahl einschränkt. Aufgrund der hohen Nachfrage der Klienten und Klientinnen und die Erfahrung und den Spaß am Medium Computer einiger Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wurde ein regelmäßig stattfindender Computerkurs ins Leben gerufen. Die Themen ziehen sich immer wiederkehrend von einfachster Hardwareinformation und Begriffsklärung bis hin zu komplizierten Datenverarbeitungsroutinen. Durch den spielerischen Aufbau an Wissen und die ersten sichtbaren Erfolgserlebnisse wird ein neuer, für das weitere Berufsleben wichtiger Bereich erschlossen. Dieser kann durch die Nutzungsmöglichkeit der vorhandenen Computer anhand von kleineren Aufgaben (z.B. eine Anwesenheitsliste mit Bildern und automatischem Datum) verfestigt werden. Die weiterführende Arbeit schult das Konzentrationsvermögen, die eigene Kreativität kann in all ihren Nuancen gefördert und von unformatiertem Text bis zur Multimedialen Movieshow wiedergegeben werden. Desweiteren werden auch die gesundheitlichen Gefahren als wichtiger Bestandteil der „computerei“ in das Bewußtsein gerufen. Der Gefahr sich nächtelang hinter den Bildschirm zu setzen und sich von der Außenwelt abzuschneiden, sowie gesundheitliche Schäden im Bereich der Haltung und der Augen soll damit entgegen gewirkt werden. Süchtiges Verhalten kann neben den anderen theraputischen Angeboten auch hier thematisiert und Alternativen, bzw gesundes-auf-sich-schauen erarbeitet werden. Als letzter Teil dieses Betreuungsangebotes steht die Weitervermittlung zu professionellen Ausbildungen durch anerkannte Hochschulen oder andere Ausbildungbetriebe und somit neben dem Spaß an dem Medium Computer auch die Verwirklichung einer beruflichen Perspektive. 8.2.2.8 Männerspezifische Angebote Durch männerspezifische Angebote können Männer ihr Fühlen und Handeln im Austausch mit anderen Männern reflektieren und sich die Basis für die Weiterentwicklung einer autonomen Geschlechtsidentität schaffen. Autonomie beschreibt hier die Integration von und die Übereinstimmung mit eigenen Gefühlen und Bedürfnissen. Der Autonomieentwicklung stehen in der männlichen Sozialisation spezifische Rollenerwartungen gegenüber. Die frühkindliche Sozialisation erfolgt in einer frauendominierten Alltagswelt, männliche Identifikationsfiguren sind dabei unterrepräsentiert. Männliche Geschlechtsidentifikation erfolgt über Distanzierung und Negation von weiblichen Identitätsanteilen. Die Wahrnehmung und Integration der Realität männlicher Lebenswelten ist kaum möglich. So kann ein illusorisches Bild der Lebensbewältigung entwickelt werden. Männerarbeit im Kontext der therapeutischen Beziehung und Gemeinschaft ermöglicht die Wahrnehmungen eigener und generell männlicher Bewältigungsprobleme in einem geschützten und frauenfreien Raum. Unzulänglichkeitserfahrungen kann die Fähigkeit zu lustvollen Problemlösungen und von autonomen Verhalten gegenübergestellt werden. Gleichzeitig ermöglicht das solidarische Erleben und Erkennen der Überforderungssituation sowie die Wahrnehmung fremder Bewältigungsprobleme die Relativierung eigener Unzulänglichkeitsgefühle. Erfahrungen mit sexuellem Mißbrauch, unangemessenen Beziehungen und erlittener oder ausgeübter Gewalt sind neben der Schwierigkeit, ambivalente Nähe-/Distanzgefühle in die Gestaltung von Beziehungen zu integrieren, Schwerpunktthemen männerspezifischer Arbeit. Durch die Bearbeitung dieser Themen in einem geschützten und solidarischen Raum, der die Schamgrenzen wahrt, kann eine neue, zufriedenere Geschlechtsidentität und Autonomie gewonnen werden. Idealisierte frühkindliche Objektrepräsentanzen können relativiert und in Einklang mit der emotionalen Wahrnehmung gebracht werden. Der gemischtgeschlechtliche Charakter der ÜWG bietet dabei ständig die Möglichkeit neue Erfahrungen zu sammeln, Übertragungen und Gefühle wahrzunehmen und diese in den männerspezifischen Betreuungsangeboten zu reflektieren. Die Entwicklung von Autonomie und Unabhängikeit wird dabei als ein lustvoller Prozeß des Entdeckens von Gefühlen und Persönlichkeitsteilen wahrgenommen. 8.2.2.9 Frauenspezifische Angebote In geschlechtsspezifischen Gruppen- und Einzelgesprächen wird individuell auf die Probleme und Themen wie Rollenverhalten, Beziehungen, Mißbrauch, Sexualität, Gewalt und Prostitution der Frauen eingegangen. Ein weiteres Angebot stellen die sozio- und psychotherapeutischen Gruppen dar, die teilweise als reine Frauengruppen stattfinden. Die geschlechtsspezifische Trennung ist nötig, um einen geeigneten Rahmen zu schaffen, in dem negative Erfahrungen (oft in Bezug auf körperlichen und/oder sexuellen Mißbrauch) bearbeitet werden können. Desweiteren werden im Bereich der Freizeitgestaltung frauenbezogene Inhalte berücksichtigt. In den hausbezogenen Veranstaltungen planen und gestalten die Bewohnerinnen eines Hauses ihre Freizeitaktivitäten. Hausfreizeiten können sowohl in Form eines Tagesausfluges, als auch in Form von mehrtägigen Reisen im In- oder Ausland stattfinden. Sie sollen den Gemeinschaftssinn der Bewohnerinnen fördern und helfen, sinnvolle und intensive Beziehungen aufzubauen und zu erhalten. Darüberhinaus kann die Konfliktfähigkeit gefördert und Kompromißfähigkeit erlernt werden. Die Einschätzung der Belastbarkeit und das Austesten von Grenzen wird den Bewohnerinnen durch eine frauenspezifische Sommerfreizeit ermöglicht. Diese findet in der Regel über einen längeren Zeitraum statt (ca. 4-6 Wochen), ist mit einem Auslandsaufenthalt verbunden, schließt unterschiedliche Aktivitäten ein und regt sowohl kulturelles Interesse als auch körperliche Betätigung an. Durch den erlebnispädagogischen Charakter wird es der einzelnen Bewohnerin ermöglicht, ihre Selbsteinschätzung realistischer wahrzunehmen, ihre Grenzen, Bedürfnisse und Fähigkeiten zu erkenen und einzubringen sowie sich in einem neuen Umfeld auszuprobieren. Angenehme Erlebnisse können ohne Drogen erfahren und unangenehme Erlebnisse ebenso ohne Drogen ertragen werden. 8.2.2.10 Situative Beratung Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der ÜWG bieten spezifische Fachberatung in den Bereichen Recht, Erziehung, HIV und Aids und Therapieplatzvermittlung an. Dabei kommt einer engen Zusammenarbeit mit bestehenden Beratungsangeboten anderer Träger entscheidende Bedeutung zu. 8.3 Medizinische Betreuung Während des Aufenthalts in der ÜWG werden die Klienten und Klientinnen von einem ortsansässigen Internisten medizinisch betreut. Dieser kümmert sich gemeinsam mit dem Klienten oder der Klientin um die Stabilisierung und Wiederherstellung der körperlichen Gesundheit. Dort können Gutachten und Befundberichte für Kostenträger weiterführender Maßnahmen, Krankenkassen, Arbeitsämter oder Gerichte erstellt werden. Zu Beginn des Aufenthalts werden alle Klienten und Klietinnen einem Psychiater und Neurologen vorgestellt. Krankheit und physische Beeinträchtigung werden in der ÜWG ständig thematisiert und in das Erleben integriert, um die Eigenverantwortung der Betroffenen für die psychische und physische Gesundheit zu fördern. In enger Kooperation mit der Immunambulanz des Städtischen Krankenhauses München Schwabing werden Klienten und Klientinnen mit einer HIV-Infektion oder einer AIDS-Erkrankung betreut und über den weiteren Krankheitsverlauf sowie etwaige Behandlungsmaßnahmen beraten. Die Drogenfreiheit wird durch unregelmäßige Urinkontrollen überprüft. Trotz der kurzen Verweilzeit in der Wohngemeinschaft gilt es, ein Höchstmaß an Selbstverantwortung für die Drogenfreiheit zu entwickeln. 8.4 Nachsorge Die Adaption von der ÜWG und damit das begleitete Anpassen an neue Lebensrealitäten ist vor, während und nach jeder Entlassung von zentraler Bedeutung. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Erreichen eines individuellen Aufenthaltsziels, ein Rückfall, ein Abbruch oder eine disziplinarische Maßnahme Grund für die Entlassung ist oder war. Jeder Klient und jede Klientin kann sich von einem Teammitglied auf seinem oder ihrem Weg nach dem Verlassen der ÜWG individuell und mit unterschiedlicher Intensität begleiten lassen. Die Nachsorge der ÜWG stellt Angebote in den Bereichen Wohnen und psychosoziale Betreuung bereit. 8.4.1Wohnen Ehemalige Klienten und Klientinnen der ÜWG haben die Möglichkeit, in von Con-drobs e.V. angemieteten Wohngemeinschaften oder Appartements zu leben. Voraussetzungen für den Einzug in eine Nachsorgewohnung ist eine regelmäßige Erwerbstätigkeit oder Ausbildung und eine weitreichende Stabilität der Drogenfreiheit, der Beziehungspflege und der Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit sich und anderen. In jeder Nachsorgewohnung können wenige ehemalige Drogenabhängige weitestgehend selbständig leben. Kleine Wohngemeinschaften erscheinen sinnvoll, da dadurch eine deutliche Abgrenzung zu den Angeboten der ÜWG erreicht wird, ohne jedoch die soziale Integration in einer Kleingruppe und die daraus resultierende Unterstützung und Sicherheit aufzugeben. Somit wird ein kontinuierlich fließender Übergang von der Therapie hin zur selbständigen Lebensführung ohne Institutionen erreicht. Das Verbleiben in größeren Gruppen würde eine Unterforderung darstellen. Dabei sind sozialpädagogische und sozialtherapeutische Interventionen zur Unterstützung notwendig. Isolierungstendenzen, Rückbezug zum früheren Milieu, Vernachlässigung der Bereiche Schule, Ausbildung oder Arbeit, persönliche Lebenskrisen und drohende Rückfälligkeit sind hierbei zentrale Themen. Die gestellten Hilfemöglichkeiten basieren auf einem klaren Klienten-Mitarbeiter-Verhältnis. Sie bleiben flexibel, individuell und intensiv. Das Untermietverhältnis zwischen Con-drobs e.V. und den Klienten und Klientinnen kann zeitlich unbefristet geschlossen werden. Drogenkonsum, Alkoholmißbrauch, Gewaltandrohung oder -anwendung können zur sofortigen Kündigung des Untermietverhältnisses führen. Die Klienten und Klientinnen versuchen in diesem Rahmen, den Lebensalltag selbständig zu gestalten und zu bewältigen. Wesentliche Aspekte sind dabei die Selbstversorgung und -verwaltung, eine geregelte Arbeit oder Ausbildung und das Aufbauen neuer sozialer Kontakte. Der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin bietet Hilfestellung an und beläßt soviel Selbstverantwortung wie möglich bei den einzelnen Gruppenmitgliedern. Darüber hinaus ermöglicht die Zusammenarbeit das Erproben konstruktiver Konfliktbewältigungsstrategien sowie in schwierigen Lebenssituationen angemessene alternative Problemlösungen zu entwickeln, Selbstsicherheit zu trainieren und somit Alltagsanforderungen besser gewachsen zu sein. Das Betreuungsangebot beinhaltet Einzel- und Gruppengespräche mit dem zuständigen Mitarbeiter oder der zuständigen Mitarbeiterin. Damit kann das vertraute Klima aus der therapeutischen Gemeinschaft in die Nachsorgewohnungen übernommen und die aktuelle individuelle Lebenssituation sowie die Suchtproblematik weiter bearbeitet werden. Eventuell auftretende Krisensituationen können im Vorfeld adäquat aufgearbeitet werden. Ein drohender Rückfall wird durch gezielte Intervention aller Anwesenden vermieden. Der Klient oder die Klientin lernt die eigenen Stärken kennen und diese sinnvoll als Alternative zum Drogenkonsum einzusetzen. Im Bedarfsfall finden weitere Einzelgespräche und Gruppensitzungen statt. Für die Nachsorgearbeit benötigt Con-drobs e.V. viele Drei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen sowie Appartements im Ballungsraum München. Diese sollten gut an das öffentliche Nahverkehrsnetz angeschlossen sein. Der monatliche Gesamtaufwand für Miete, Mietnebenkosten, Heizung und Strom darf den wirtschaftlich verantwortbaren Rahmen der Klienten und Klientinnen nicht überschreiten. Eine zu hohe finanzielle Belastung ist zu vermeiden, da sonst die finanzielle Unabhängigkeit vom örtlichen Träger der Sozialhilfe nicht mehr sichergestellt ist. Die Miet- und Mietnebenkosten sowie eine Verwaltungspauschale werden von den Klienten und Klientinnen selbst getragen. Ziel des Angebots ist eine weitreichende Reintegration in das normale Wohnmilieu. Es ist möglich, daß die jeweiligen Klienten und Klientinnen der Nachsorgewohnungen später als Hauptmieter in die entsprechenden Mietverträge übernommen werden. Das Nachsorgeprojekt unterstützt Menschen, die eine Therapie abschließen oder aus betreuten Wohngemeinschaften ausziehen, bezahlbaren und den Bedürfnissen angemessenen Wohnraum zu finden. Dies soll insbesondere durch eine verstärkte Zusammenarbeit mit städtischen Wohnungsbaugesellschaften sowie privaten und kommunalen Vermietern und Vermieterinnen erreicht werden. Darüber hinaus werden Zimmer in Dauerwohngemeinschaften vermittelt. Klienten und Klientinnen von Appartements oder Wohngemeinschaften, die nicht von Con-drobs e.V. angemietet wurden, können ebenfalls von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der ÜWG Krisenhilfe und dauerhafte Betreuung in Form von Einzel- oder Gruppengesprächen erhalten. 8.4.2 Psychosoziale Betreuung Die Einzelberatung und -betreuung wird nach den individuellen Bedürfnissen und Erfordernissen eines und einer jeden einzelnen ausgerichtet. Regelmäßige Kontakte können geschaffen und nach dem aktuellen Bedarf neu vereinbart werden. Der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin sucht die Klienten und Klientinnen in ihren Wohnungen oder an anderen Plätzen auf und bietet Treffen in den Nachsorgeräumen an. Die Betreuung kann sich auf konkrete inhaltliche Hilfen wie Schuldnerberatung, Arbeitsberatung oder Vermittlung in ambulante Psychotherapie begrenzen, sie kann aber auch die Form einer intensiven ambulanten Therapie annehmen. Darüberhinaus können unterschiedlich gestaltete und organisierte Gruppen angeboten werden. Ungelöste Schuldenprobleme können vorhandene Ansätze von Stabilisierung, insbesondere die Lösung von Arbeits- und Wohnungsproblemen, in Frage stellen. Die Begleitung bei der Regulierung von Schulden ist gerade dann, wenn Arbeit wieder aufgenommen wird und Gläubiger auf die Klienten und Klientinnen zukommen, von hoher Bedeutung. Die damit verbundenen Schwierigkeiten und fehlende Schuldentilgungspläne lösen Verunsicherungen über die Arbeitssituation und Angst vor einem Arbeitsplatzverlust aus. Sofern die Intensität und Tiefe der Einzelberatung die Ressourcen der Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen überfordert, können Klienten und Klientinnen in ambulante Therapien bei Drogenberatungsstellen oder freien Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen vermittelt werden. Entsprechende Angebote werden von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen erschlossen. In jeder Lebensphase kommt es zu Krisen, davon bleiben die meisten Klienten und Klientinnen auch in der Nachsorge nicht verschont. Um Rückfälle zu vermeiden und effektiv helfend und unterstützend zu wirken, ist ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin jederzeit in der ÜWG erreichbar. Zudem kann auf eine Krisenwohnungen zurückgegriffen werden, in denen Klienten und Klientinnen kurzfristig (sofort) und kurzzeitig (wenige Wochen) untergebracht werden können. Die Krisenwohnung ist unbürokratisch und schnell erreichbar und bietet ein Mindestmaß an Sicherheit und Stabilität. Klienten und Klientinnen, die dauerhaft rückfällig werden, bedürfen einer längeren Betreuung und können in der Regel nicht weiter ambulant durch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der ÜWG betreut werden. Um einen direkten Übergang der Betreuung zu ermöglichen, sind gute Kontakte zu Drogenberatungsstellen und Entzugsstationen notwendig. Nach dem Entzug benötigen Klienten und Klientinnen mit Therapieerfahrung oftmals nur eine kurzfristige intensive Unterstützung und Betreuung, um zu einem cleanen Leben zurückzufinden. Dabei stehen aktuelle Problemlagen und die Entscheidung für weitere therapeutische Perspektiven oder zur Rückkehr in die vorhandenen Lebensbezüge im Vordergrund. 8.4.3 Freizeitgestaltung Die Betreuungsangebote der ÜWG im Bereich der Freizeitgestaltung und Erlebnistherapie stehen ambulant oder stationär betreuten Klienten und Klientinnen der Nachsorge offen. 9 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Der Arbeitsplatz aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen befindet sich in den Räumen am Jägerring 8e. Dort stehen ein Raum für die Verwaltung (Teambüro) und ein Raum für Besprechungen (Teamzimmer) zur Verfügung. Die Tätigkeit in der ÜWG kann - durch den Aufbau einer Modelleinrichtung ohne vorgegebene Konzeption, durch die starke Außenorientierung des Angebots, das geforderte Maß an Eigenverantwortung der Klienten und Klientinnen, den offenen Charakter, die unterschiedlichen Problemfelder, die verschiedenen Zielgruppen mit ihren unterschiedlichen Zielvorgaben, durch z.T. sehr unmotivierte Klienten und Klientinnen, hohe Abbruch- und Rückfallraten, die stark wechselnde Belegungsdichte, die hohe Fluktuation der zu Betreuenden und durch die große Nähe zur Drogenscene und deren Verhaltensmustern - als besonders schwierig und bedeutsam bewertet werden. Die stark wechselnde Belegungsdichte erfordert von den Teammitgliedern ein hohes Maß an Flexibilität hinsichtlich der Differenziertheit und der Intensität des Betreuungsangebots und der Betreuungsdichte. Sie müssen einen schnellen Zugang zum Klientel finden und häufig zusammen mit unmotivierten oder fremdmotivierten Klienten und Klientinnen individuelle Betreuungs- und Beratungsangebote erarbeiten und durchführen. Viele Klienten und Klientinnen versuchen, das Angebot der ÜWG für Drogenabhängige als Alternative zum Strafvollzug zu mißbrauchen. Da dies konzeptionell ein legitimer Zugang ist, müssen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die damit einhergehenden Haltungen von Zwang, Druck und Unfreiheit auflösen und eine Grundstimmung der konstruktiven Veränderungsbereitschaft erreichen. Die Konzeption der ÜWG sieht keine einheitliche Klienten- und Klientinnenstruktur vor, sondern bietet unterschiedlichen Zielgruppen mit individuell zu erarbeitenden Zielvorgaben die Möglichkeit zur Orientierung und zur Entscheidungsfindung. Daher können keine standardisierten Handlungsschemen entwickelt und angewandt werden. Es müssen individuelle Betreuungs- und Therapiepläne entworfen werden, die die jeweiligen Rahmenbedingungen, Regeln, Gebote und Verbote vorgeben. Dabei müssen die unterschiedlichen Problemfelder, wie sexueller Mißbrauch, Vergewaltigung, HIV-Infektion, Hetero-, Bi- und Homosexualität, Prostitution, Beziehungsschwierigkeiten, Scheidung und Trennung, Schwangerschaft, Elternkonflikte, Mutter- und Vaterschaft, psychische Krankheiten und Störungen, Schuldensituation, Arbeits- und Berufslosigkeit, physische Erkrankungen und Strafverfolgung in ihrer Komplexität und mit ihrem wechselseitigen Bedingungsgefüge integriert werden. Der offene Rahmen der Einrichtung erfordert ein hohes Maß an Erziehung zur Selbstverantwortung. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geben dabei Verantwortung an die Klienten und Klientinnen ab. Hierbei ist es wichtig, Über- und Unterforderungen zu vermeiden und ihnen ein adäquates Maß an Eigenverantwortung zu übergeben. Häufig ist dabei zu beobachten, daß die Bereitschaft zur Eigenverantwortung fehlt, so daß der Prozeß des Mündigwerdens sehr ambivalent verläuft. Die Außenorientierung der Klienten und Klientinnen führt zu einer großen Realitätsnähe. Der geringe Grad der Isolierung erfordert die ständige Bereitschaft der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Krisenintervention und zur Auseinandersetzung mit Themen des Draußens. Das Erkennen und Einhalten der eigenen Grenzen und die Achtung der Grenzen von anderen ist integraler Bestandteil menschlicher Beziehungen. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit klaren Strukturen und Grenzen können den Klienten und Klientinnen Orientierung, Sicherheit, Schutz und die Möglichkeit zu offenen Auseinandersetzungen geben. Der Umgang mit den eigenen Grenzen ist nicht nur unabdingbare Voraussetzung für die Beziehungsarbeit mit Drogenabhängigen, sondern notwendiges Handwerkszeug, um in der Vielfalt der Anforderungen nicht unterzugehen. 9.1 Leitung Die Leitung der ÜWG obliegt dem Leiter oder der Leiterin und zwei stellvertretenden Leitern oder der stellvertretenden Leiterinnen. Sie wird durch den Vorstand, die Geschäftsführung, die Geschäftsleitung und durch einen Organisationsmitarbeiter oder eine Organisationsmitarbeiterin beraten. Die Dienst- und Fachaufsicht über den Leiter oder über die Leiterin hat der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin von Con-drobs e.V., Dienst- und Fachvorgesetzter der stellvertretenden Leiter oder Leiterinnen ist der Leiter oder die Leiterin. Die Leitung ist in ihrer Entscheidungsfindung eigenständig und hat ein Vetorecht gegen alle Entscheidungen des Projekt-, Case- und Nachtdienstteams. Entscheidungen werden mit einfacher Stimmenmehrheit der Anwesenden getroffen. Die Ergebnissicherung erfolgt über schriftliche Dienstanweisungen und Protokolle. Zentrale Aufgabe der Leitung ist die Gesamtverantwortung für die Einrichtung, Personalführung, Projektplanung, Belegung, Kontrolle der Umsetzung von Anweisungen und Beschlüssen, Moderation der Projektteambesprechungen und der Projektgruppe, Informationsweitergabe und der Haushalt. Darüberhinaus ist die Leitung für administrative Aufgaben wie Statistik, Akquirierung von Geldmitteln, Infrastruktur der Einrichtung, Aufnahmeverfahren, Personalverwaltung, Außenvertretung und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. Der Leitung untersteht im Sinne einer Stabstelle die Verwaltung der Einrichtung. Die Verwaltungsmitarbeiter und Verwaltungsmitarbeiterinnen sind für die Kasse, Abrechnung, Zusammenarbeit mit der toxikoligischen Abteilung, Dienstplanauswertung und -abrechnung, Ablage, Bibiliothek, Inventarisierung sowie für den Postein- und Ausgang, Schreibarbeiten und Materialeinkauf zuständig. 9.2 Projektteam Alle projektbezogenen und haus- bzw. kleingruppenbezogenen Betreuungsangebote werden von dem Projektteam getragen. Diesem gehören alle Ex-User, Ex-Userinnen, Diplom Psychologen, Diplom Psychologinnen, Diplom Sozialpädagogen und Diplom Sozialpädagoginnen an. In der wöchentlichen Projektteambesprechung werden Entscheidungen mit einfacher Stimmenmehrheit der Anwesenden getroffen. Die Ergebnissicherung erfolgt über Protokolle. Das Projektteam wird durch die Leitung beraten und von einem externen Supervisor oder durch eine externe Supervisorin begleitet. Die Dienst- und Fachaufsicht über die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Projektteams obliegt dem Leiter oder der Leiterin. Zentrale Aufgabe des Projektteams ist die Informationsweitergabe über Klienten und Klientinnen, Gruppen, Kriseninterventionen und alltäglichen Kontakten. Dem Projektteam obliegt die Umsetzung der Konzeption in inhaltlichen, methodischen, strukturellen und organisatorischen Fragen. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Projektteams sind für die projektbezogene Betreuung in Form von alltäglichem Kontakt, Beziehungsarbeit, Krisenhilfe und Kontrolle der Drogenfreiheit sowie für die themenzentrierten Angebote und für die Nachsorge zuständig. 9.3 Case-Teams Jeweils zwei therapeutische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (Case-Mangager, Case-Managerinnen) aus dem Projektteam sind für die Gruppen- und Einzelbetreuung der Klienten und/oder Klientinnen eines Hauses bzw. einer Erlebnisgemeinschaft sowie für die Organisationsstruktur zuständig. Sie bilden in den Erlebnisgemeinschaften und in der Realisierungsphase ein gemischtgeschlechtliches und in der Orientierungsphase ein gleichgeschlechtliches Case-Team (Fall-Team). 9.4 Nachtdienst In der ÜWG II und III werden die Klienten und Klientinnen in der Zeit von 22.00 Uhr bis 08.00 Uhr von jeweils einem externen Nachtdienstmitarbeiter oder einer externen Nachtdienstmitarbeiterin betreut. Der Betreuungsschwerpunkt liegt hier auf Krisenhilfe, der Kontrolle der Grund- und Projektregeln und dem lebendigen Kontakt zu den Klienten und Klientinnen. 10 Finanzierung Grundgedanke der Finanzierung der ÜWG ist eine größtmögliche Eigenbeteiligung der Klienten und Klientinnen an den laufenden Kosten. Dadurch wird deren Selbstverantwortung für die Situation gefördert und eine Orientierung an Realitäten ermöglicht. Unter der Berücksichtigung einer Pflegesatzfinanzierung der Personal- und Sachkosten für zwölf Plätze in den Erlebnisgemeinschaften (Antrag 1995) und für 24 Plätze in der ÜWG II und III durch den Bezirk Oberbayern und der pauschalen Finanzierung der Personalkosten für zwölf Plätze in der ÜWG II und III durch den Freistaat Bayern und die Regierung von Oberbayern beteiligen sich die Klienten und Klientinnen der ÜWG II und III anteilig an den laufenden Miet- und Mietnebenkosten. Alle mit der Lebenshaltung verbundenen Kosten müssen sie ebenfalls selbst aufbringen. Der mit dem Bezirk Oberbayern 1995 zu vereinbarende Pflegesatz für die Erlebnisgemeinschaften wird die Personalkosten für sieben therapeutische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie einen Reiseverkehrskaufmann oder eine Reiseverkehrskauffrau, die mit dem Umherreisen verbundenen Kosten, die Lebenshaltungskosten der Klienten und Klientinnen und andere Sachkosten decken. Durch einen Pflegesatz für 24 Klienten und Klientinnen und die pauschale Finanzierung von 12 Plätzen sind alle Personalkosten für einen Diplom-Psychologen oder eine Diplom-Psychologin, einen ex-User oder eine Ex-Userin, zehn Diplom-Sozialpädagogen oder Diplom-Sozialpädagoginnen, einen Verwaltungsmitarbeiter oder eine Verwaltungsmitarbeiterin, einen Praktikanten oder eine Praktikantin, einen Zivildienstleistenden und für 14 Nachtdienste abgedeckt. Gleiches gilt für entsprechende Sachkosten. Für Klienten und Klientinnen der ÜWG II und III, die kein eigenes Einkommen und kein Arbeitslosen-, Überbrückungs-, Übergangs- oder Krankengeld beziehen, übernimmt der örtliche Träger der Sozialhilfe nach den Richtlinien des Bundessozialhilfegesetzes die Lebensunterhaltskosten und Krankenversicherung. Sollte das eigene Einkommen zur Sicherung des Aufenthaltes nicht ausreichen, kann ebenfalls Antrag auf Sozialhilfe oder Wohngeld gestellt werden. Entsprechende Anträge müssen erst nach der Aufnahme gestellt werden. Da nicht durchgehend mit einer hundertprozentigen Belegung gerechnet werden kann, hat die Landeshauptstadt München eine 20%ige Mietausfallkostenpauschale für die in der ÜWG II und III nicht gedeckten Kosten bewilligt. Durch die räumliche Anbindung der sechs Häuser können die Betreuungskosten sehr gering gehalten werden. Zudem werden Betreuungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten von den Klienten und Klientinnen aller Häuser genutzt. Grundlage der Finanzierung sind neben der pauschalen Bezuschussung die Bestimmungen in §§ 39, 40 BSHG. Die unter dem Kapitel Zielgruppe beschriebenen Menschen gehören dem in §39 BSHG beschriebenen Personenkreis an. Sie sind zum Zeitpunkt der Aufnahme in die ÜWG länger als 6 Monate seelisch wesentlich behindert. Die seelische Behinderung resultiert aus einer psychischen und physischen Schädigung und geht einher mit funktionellen Beeinträchtigungen im Leben und im sozialen Verhalten die zu Benachteiligungen und zur reduzierten Verwirklichung allgemeiner Lebensinteressen führen. Die Fähigkeit zur Eingliederung oder Teilnahme am Leben in der Gesellschaft ist infolge der seelischen Störung im erheblichen Umfang beeinträchtigt und wesentlich erschwert. Deshalb bedürfen die Klienten und Klientinnen der ÜWG besonderer pädagogischer und therapeutischer Förderung. 11 Evaluation Die ÜWG verfügt über ein wissenschaftlich begründetes Therapiekonzept. Die Effektivität der Betreuung ist hinsichtlich struktureller und prozessualer Aspekte, der Personalausstattung, dem Ausbildungsstand der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, der Qualität und Quantität der angebotenen Betreuungs- und Therapieangebote sowie der Ergebnisse des Aufenthalts in der ÜWG überprüfbar. Als Maßnahme zur kontinuierlichen Qualitätssicherung der Betreuungs- und Therapieangebote wird eine summative und differentielle Evaluation der Konzeption und der Maßnahmen durchgeführt. Damit kann die Qualität abgesichert und verbessert sowie eine bedarfsgerechte, regelmäßige und den neusten Erkenntnissen ensprechende Versorgung der Klienten und Klientinnen in der ÜWG gewährleistet werden. Die Angebote der ÜWG sind ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich vertretbar. Der Einsatz einer eigens für die spezifischen Anforderungen der ÜWG erarbeiteten Basisdokumentation ermöglicht eine exakte anonymisierte Auswertung aller relevanter Klienten- und Klientinnendaten, der Krankheitsgeschichten, der Diagnosen, der Indikationsstellungen und der Maßnahmen sowie der mit der Entlassung einhergehenden Umstände. Daraus läßt sich erkennen, für welche Klienten und Klientinnen welche Maßnahme zu welchem Ergebnis führt. Die vorliegende Konzeption wird ständig weiterentwickelt, praxisnahe Erfahrungen können so kontinuierlich einbezogen werden. Die Konzeptevaluation beschäftigt sich mit der Betreuungsplanung, deren Umsetzung, dem Indikationsmodell sowie der Evaluation zentraler Konzepthypothesen und der Effektivität der gesamten Betreuung. Ein Leitfaden zur selektiven und adaptiven Indikation wird derzeit erarbeitet. Eine katamnestische Studie über die Wirkungsweise und den Erfolg der Maßnahmen wird angestrebt. Am 16.04.1992 wurde der Antrag auf Bezuschussung einer wissenschaftlichen Begleitung für die ÜWG beim Bayerischen Staatsministerium für Arbeit, Familie und Sozialordnung gestellt. Um die geplante wissenschaftliche Begleitung strukturell, methodisch, fachlich und personell verantwortlich durchführen zu können, wird eine enge Kooperation mit einem anerkannten wissenschaftlichen Institut angestrebt, das, falls die von uns beantragte Untersuchung akzeptiert und gefördert wird, ein präzises Untersuchungsprospekt entwickeln und vorlegen wird. Die Untersuchungen sollen sich an folgenden Fragestellungen orientieren: n Die ÜWG bietet den Klienten und Klientinnen einen im Verhältnis zu anderen teil- oder vollstationären Angeboten der Drogenhilfe sehr offenen Lebensraum. Die Selbstbeteiligung der Klienten und Klientinnen bei der Erarbeitung von Regeln führt zu einer frühzeitigen Übernahme von Verantwortung hinsichtlich der Alltagsgestaltung und der Aufrechterhaltung der Hausregeln. Es soll überprüft werden, inwieweit individuelles Wachstum und dessen Förderung in einem so strukturierten Lebensraum möglich und sinnvoll ist. nOrientierung und Motivation sind zwei Leitgedanken der ÜWG. Während des Aufenthalts können die Klienten und Klientinnen die Motivation für eine ambulante oder stationäre Therapie neu entwickeln oder weiter festigen. Die dafür notwendigen kognitiven und emotionalen Voraussetzungen können erarbeitet werden. Es soll überprüft werden, inwieweit die ÜWG die Motivation für eine anschließende Therapie fördert, stabilisiert oder behindert, und somit auf eine für die Betroffenen sicherere oder unsicherere Basis stellt. nDie Klienten und Klientinnen werden durch die Kontaktmöglichkeiten nach draußen weiterhin mit den alltäglichen Lebensrealitäten konfrontiert. Ihre Aufmerksamkeit, ihre Informationen, ihre Kontakte werden, wenn auch eingeschränkt, stark von außen bestimmt. Es soll überprüft werden, inwieweit der Realitätskontakt das Einlassen auf die Zeit in der ÜWG und das Zusammensein mit der Gruppe behindert oder fördert. nDie Wiederaufnahme nach einer vorangegangenen regulären oder irregulären Entlassung ist nach einer bestimmten Erprobungszeit grundsätzlich möglich. Damit wird berücksichtigt und gewürdigt, daß der Rückfall Bestandteil des Lebens- und Ausstiegsprozesses eines Süchtigen ist und für den (Selbst-) Heilungsprozeß genutzt werden kann. In der Zeit des Rückfalls können Lernprozesse von den Betroffenen selbst oder mit Unterstützung und Beratung durch Beratungsstellen oder Teammitglieder der ÜWG initiiert werden. Es soll überprüft werden, inwieweit die Phasen zwischen den Aufenthalten in der ÜWG insgesamt gesehen zur Stabilisierung, zur Festigung und Klärung der Orientierung sowie zu größerer Distanz zur Drogenabhängigkeit führen kann. nDie meisten Klienten und Klientinnen kommen mit (vor-) formulierten Zielvorstellungen hinsichtlich weiterer Therapiemaßnahmen in die ÜWG. Viele verändern diese Zielvorstellung im Laufe der Zeit und orientieren sich neu. Es soll überprüft werden, inwieweit diese Entwicklung Eigenmotivation fördert, inwieweit die vorab formulierten Ziele und Motive aufgesetzt, oberflächlich oder erzwungen waren und inwieweit die Zeit in der ÜWG zu einer ehrlicheren Selbsteinschätzung und Haltung zu eigenen Bedürfnissen führt. nSchon nach wenigen Wochen hat die Arbeit der ÜWG im Gesamtzusammenhang der Drogenhilfe und für die Drogenabhängigen selbst einen großen Stellenwert erhalten. Die dabei entstehenden Wartezeiten zerstören den bedeutsamen Konzeptpunkt der schnellen Erreichbarkeit als einen wesentlichen Teil von Niederschwelligkeit. Die Erweiterung des Angebots um 12 Plätze ist dringend erforderlich; mit der Realisierung soll sobald als möglich begonnen werden. Die damit einhergehende Differenzierung ermöglicht die räumliche Trennung der zentralen Zielgruppen. Es soll überprüft werden, wie die Arbeitsansätze durch die dann mögliche Themenkonzentrierung erleichtert bzw. intensiviert werden können. nEin wesentliches Merkmal im Unterschied zu allen bestehenden teil- und vollstationären Einrichtungen der Drogenhilfe ist die Tatsache, daß die Klienten und Klientinnen selbstständig für die Finanzierung des Aufenthaltes in der ÜWG Sorge tragen müssen. Es obliegt ihrer Verantwortung, mit Behörden und sonstigen Institutionen die Finanzierungsgrundlage des Aufenthaltes in der ÜWG zu gewährleisten. Für viele Klienten und Klientinnen ist auch die eigene berufliche Tätigkeit Voraussetzung dafür, den Aufenthalt in der ÜWG finanzieren zu können. Hier wird Selbstständigkeit und eigene Verantwortung gefordert. Es soll überprüft werden, inwieweit die Eigenverantwortung für die Finanzierung des Aufenthaltes in der ÜWG zur Selbstständigkeit, zur eigenen Zuständigkeit für die Lebensgestaltung und zur selbständigen Bewältigung des Alltags beiträgt. Wir sind der Auffassung, daß diese Grundhaltung eine wesentliche Voraussetzung zum Aufbau eines eigenständigen und drogenfreien Lebens darstellt. nBei den meisten drogenabhängigen Männern und Frauen wächst in der Phase der Distanzierung vom Konsum illegaler Drogen die Neigung, diesen Drogenmißbrauch durch andere Formen süchtigen Verhaltens zu ersetzen. Es soll überprüft werden, inwieweit Suchtverlagerung als individuelle Ressource genutzt und mit zufriedenstellenden und freudvollen Alltagserfahrungen verbunden werden kann. Es wird vermutet, daß eine kritische Auseinandersetzung und eine Offenlegung dieser Neigungen die Chance eröffnet, positive, für den einzelnen attraktive, Lebensinhalte zu finden und damit stabilisierend zu wirken. nDie Aufenthaltsdauer richtet sich in der ÜWG nach individuellen Kriterien und ist zeitlich nicht befristet. Es soll untersucht werden, inwieweit ein Zusammenhang zwischen Aufenthaltsdauer und dauerhafter Abstinenz besteht.In der ersten praktischen Arbeitsphase der wissenschaftlichen Begleitung sollen diese aktuellen Fragestellungen auf die wichtigsten Leitlinien der Untersuchung zentriert werden. Darüber hinaus sollen Kriterien zur Indikationsstellung erarbeitet werden. Die Laufzeit der wissenschaftlichen Untersuchung beträgt drei Jahre. Dies ist ein Zeitraum, in dem eine angemessene Zahl von Klienten und Klientinnen katamnestisch mit den zu erarbeitenden Fragen begleitet werden kann. Es handelt sich gleichzeitig um einen verantwortbaren Zeitraum, in dem die Entwicklung einzelner beim Aufbau eines drogenfreien Lebens, in ihrer weiteren süchtigen Entwicklung oder bei wiederholten Abstinenzversuchen begleitet werden kann. Die wissenschaftliche Begleitung soll in Form einer teilnehmenden und mitarbeitenden Untersuchung geschehen. Ein Diplom-Psychologe mit 38,5 Wochenstunden und ein Diplom-Sozialpädagoge mit 19,25 Wochenstunden werden in die Alltagstätigkeiten des Teams eingebunden und können für die Arbeit wichtige Begleit- und Betreuungsaufgaben wahrnehmen. In der zweiten Hälfte ihrer Tätigkeit bündeln sie die Ergebnisse und Erfahrungen und bestimmen weitere Schritte, intensivieren den Kontakt mit den institutionellen Stellen, führen aktuelle Fragestellungen zurück ins Team und erhalten wissenschaftliche Supervision, um die notwendigen Auswertungen durchführen zu können. Diese Form der Einbindung schränkt die übliche Objektivität wissenschaftlicher Arbeit ein. Dagegen stehen konkretere und praktischere Ergebnisse, die nur durch eine praxisnahe Beobachtung erlangt werden können. Der zur glaubhaften Objektivität notwendige Grad der Distanz kann durch die enge Anbindung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an ein anerkanntes wissenschaftliches Institut gewährleistet werden. Neben den Personalkosten müssen die erforderlichen Sachkosten finanziert werden. Ein jährlicher Etat für die wissenschaftliche Begleitung in Höhe von DM 140.000,-- ist notwendig. 12 Perspektiven Die ÜWG hat seit ihrem Bestehen vielfältige Erfahrungen mit neuen und alten Handlungsansätzen gesammelt. Daraus ergab sich die Notwendigkeit der Differenzierung und Erweiterung der Betreuungsangebote und der Betreuungskapazität. Darüber hinaus sind in diesem Konzept erstmalig konzeptionelle Überlegungen zu einer Erlebnisgemeinschaft formuliert. Wir hoffen in der zweiten Jahreshälfte 1995 zwei Erlebnisgemeinschaften realisieren zu können. Über die in diesem Konzept betonten Notwendigkeiten hinaus ergeben sich aus den in der ÜWG gesammelten Erfahrungen weitere zwingende Forderungen: Die Angebote der stationären Therapie für Drogenabhängige müssen in ihrer Breite und Tiefe weiter differenziert, flexibilisiert und individualisiert werden. Nur so können im stationären Therapiebereich tatsächlich adäquate Angebote gewählt werden. Die Attraktivität dieser Therapien muß durch mehr Realitätsbezug wesentlich vergrößert werden. Die Zugangsvoraussetzungen der stationären Therapieeinrichtungen müssen die in den Übergangseinrichtungen erreichten Veränderungen integrieren und einen Quereinstieg in bestehende Angebote ermöglichen. Hilfe in Krisensituationen und bei manigfaltigen Überforderungen läßt sich mit einem individualpädagogischen Ansatz auch bei drogenabhängigen Männern und Frauen, die nicht oder nur sehr bedingt gruppenfähig sind als persönlichkeits- und identitätsbildender Proezß im Rahmen einer „Einzelbetreuung auf Reisen“ realisieren. Dabei wäre der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin in der Beziehung zu dem Klienten oder der Klientin nicht nur Spiegel im Verantwortungsbereich sondern konkreter Reflexions- und Bezugspartner oder -partnerin. Damit würde Authentizität sowie Vertrauen gefordert und gefördert. Der Klient oder die Klientin könnte sich selbst als wertvoll erleben und somit einen wichtigen Schritt in der Identitäts- und Persönlichkeitsnachbildung gehen. Die Begleitung des Übergangs zwischen Szene und Therapie kann nicht zwingend drogenfrei erfolgen. Das Therapieziel Drogenfreiheit würde ad absurdum geführt, wenn es in jedem Fall bereits in der therapievorbereitenden Phase als Aufenthaltsvoraussetzung angesehen würde. Daher erscheint ein Haus, in dem Wartezeiten auf einen Therapieplatz den Drogenkonsum akzeptierend, überdauert werden können, sinnvoll. Die geplante körperliche Entgiftung und der anschließende Therapiebeginn würden den Abschluß eines solchen Angebotes darstellen. 13 Trägerschaft Die ÜWG wird in ihrer Gesamtheit unter der Trägerschaft des Vereins Con-drobs e.V. geführt. Der Verein und seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben seit Jahren die Notwendigkeit zusätzlicher Hilfsangebote erkannt und betont. Sie haben hiermit ein kompetentes, sinnvolles und neu überarbeitetes Konzept vorgelegt. Wir werden weiterhin in Kooperation mit anderen Einrichtungen der Drogenhilfe dafür Sorge tragen, daß die ÜWG ein sinnvolles Glied in der Vernetzung von Hilfsmaßnahmen für Drogenmißbraucher und Drogenmißbraucherinnen und Drogenabhängige darstellt. Das hier beschriebene Projekt steht vorrangig drogenabhängigen Menschen aus dem Großraum München sowie aus Oberbayern und Bayern offen; aus dem übrigen Bundesgebiet können jedoch ebenfalls Klienten und Klientinnen aufgenommen werden. Auf den Ballungsraum München bezogen arbeitet die ÜWG eng mit den Beratungsstellen der Landeshauptstadt München, der Prop-Alternative, von Con-drobs e.V. und der Caritas zusammen. Als Entgiftungseinrichtungen stehen potentiellen Klienten und Klientinnen die Toxikologische Abteilung des Klinikums Rechts der Isar, die Entzugsabteilung Die Villa des Städtischen Krankenhauses München Schwabing, die Bezirkskrankenhäuser Haar, Gabersee und Taufkirchen sowie die Universitätsnervenklinik Nußbaumstraße zur Verfügung. 14 Ortsbeschreibung Das Anwesen am Jägerring 8 in Eglharting umfaßt 2.000 qm Grund; alter Baumbestand und ausreichend Freiflächen sind vorhanden. Das Gebäude gliedert sich in vier Reihenhäuser mit durchschnittlich 160 qm Wohnfläche und einer, über dem Gruppenraum liegenden Einliegerwohnung mit zwei Räumen in denen die Verwaltung und das Teamzimmer untergebracht sind. Zudem sind drei Garagen als Lagerräume und neun Stellplätze für Kraftfahrzeuge vorhanden. Nur etwa 400 Meter entfernt am Kirchseeonerweg Ecke Birkenweg stehen der ÜWG zwei benachbarte Doppelhaushälften mit jeweils 240 qm Wohnfläche, zwei Garagen und zwei Stellplätzen auf einem etwa 800 qm großen Grundstück zur Verfügung. Jedes der sechs Reihen- bzw. Doppelhäuser bietet sechs Menschen einen großzügigen Wohn- und Eßbereich mit Wintergarten, drei bis vier Schlafzimmer, eine Küche, zwei Bäder, einem Gäste-WC, einer Waschküche, einem Abstell- und einen großen Hobbyraum. Die Anwesen liegen etwa 25 km östlich von München in Eglharting bei Ebersberg und sind gut an das öffentliche Verkehrssystem des Ballungsraumes München angeschlossen. Mit der S-Bahn fährt man lediglich 35 Minuten zur Stadtmitte. In der näheren Umgebung findet man zahlreiche kleinere Seen, große Waldgebiete, eine Sportanlage und zahlreiche andere Freizeitmöglichkeiten. Zudem bietet der Landkreis Ebersberg eine gute Arbeitsmarktlage, so daß hier leicht ein passender Arbeits- oder Ausbildungsplatz gefunden werden kann. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln sind die Häuser von München aus mit der S5 Richtung Ebersberg Haltestelle Eglharting zu erreichen. Autofahrer und Autofahrerinnen folgen von München kommend, der Wasserburger Landstraße durch Haar, die A 99 (Ostumgehung München) überquerend weiter durch Baldham und Zorneding, bis sie nach Eglharting kommen. |
|||
| [Home] [Lebenslauf] [Veröffentlichungen] [Referate] [Projekte] [Abstrakts] [Angebote] [Bilder] [Links] |